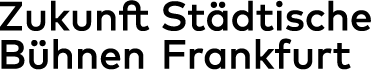Studienarbeit „Theater Provisorium Frankfurt“, Universität Kassel
Erschienen in der F.A.Z., am 23. Januar 2020
Mit 874 Millionen Euro rechnet die Stadt Frankfurt für den Neubau von Theater und Oper. Es ist gut, wenn sich eine Gesellschaft ihre Kulturbauten viel kosten lässt. Aber wie viel Techno-Luxus muss wirklich sein?
Von Niklas Maak
Das war’s. Es ist vorbei. Wenn man dem Prüfbericht und den Schlussfolgerungen folgt, die Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig daraus zieht, ist das Doppeltheater am Frankfurter Willy-Brandt-Platz nicht zu sanieren. Die Stadt rechnet einen zwingenden Abriss herbei: Wenn man nur das Nötigste mache, lande man bereits bei einer beachtlichen Summe von 826 Millionen Euro. Die „verbesserte Sanierung“, bei der „gewisse Grundmakel wie die vielen unterschiedlichen Ebenen und Treppen bestehen“ blieben und es auch gar nicht zu „Verbesserungen der künstlerischen Bedingungen“ komme, koste sogar 918 Millionen – womit beide Varianten „nicht zukunftsfähig, nicht wirtschaftlich und nicht nachhaltig“ seien. Hartwig spricht sich dementsprechend für Neubauten aus, die den „Stand der Technik“ erfüllen und einen „zukunftsfähigen“ Betrieb ermöglichen.
Es bleiben damit nur zwei Varianten übrig – der Bau einer neuen Doppelanlage für Theater und Oper am selben Standort, was nach den Rechenspielen der Berichtsverfasser mit 874 Millionen Euro zu Buche schlagen würde, oder zwei Neubauten an zwei verschiedenen Stellen der Stadt. Das bedeutet wahrscheinlich, dass das Theater am Willy-Brandt-Platz bliebe und die Oper „an einen zentral gelegenen Standort“, etwa an den Osthafen zieht. Die Kosten dafür werden mit 809 Millionen Euro beziffert, weil man in diesem Fall nur eine Interimsspielstätte benötigte.
Eine Frankfurter Elbphilharmonie?
Nimmt man die Zahlen und Argumente so hin, wäre die Marschrichtung klar: Die 1963 eingeweihte, von dem Büro Apel und Beckert entworfene Theaterdoppelanlage muss abgerissen werden. Mit ihr würde ein weiterer jener klassisch modernistischen, großzügig verglasten öffentlichen Bauten im Stil der Mies-van-der-Rohe-Moderne verschwinden, mit der sich Deutschland nach 1945 eine neue Identität gab. Die optische Offenheit von damals wird auch hier dem Bau nicht zuletzt aufgrund der neuen Dämmstandards zum Verhängnis. Die Rechenkunst der Prüfer macht es den Denkmalschützern schwer: Kann man ernsthaft für fast eine Milliarde Euro nur den Ist-Zustand mitsamt aller „Grundmakel“ erhalten wollen, wenn man für über einhundert Millionen weniger zwei brandneue Theater bekommt – zumal in der Neubauvariante schon „angemessene Risikozuschläge“ und die Baukosten für ein eigenes Produktionszentrum beinhaltet sind? Hartwigs Plan scheint vernünftig, eine Bühne am Willy-Brandt-Platz (und so die Kultur im Herzen Frankfurts am angestammten Platz) zu belassen, mit der anderen aber der Stadt ein weiteres leuchtendes kulturelles Zentrum zu schenken; mehrfach machte schon das Wort von einer „Frankfurter Elbphilharmonie“ die Runde.
Das Hamburger Beispiel erinnert freilich auch daran, dass geplante Baukosten sich bei sogenannten kulturellen Leuchttürmen durchaus auch verzehnfachen können. In der vergangenen Zeit haben dank der großzügigen Steuergeldvergabepolitik von Kulturstaatsministerin Grütters die Worte „vorläufig“ und „ungefähr“ bei den Baukosten von kulturellen Prestigeprojekten neue Unschärferekorde erreicht: Man denke nur an das geplante Berliner Museum der Moderne, bei dem Politik und Architekten die zunächst bewilligten 200 Millionen Euro rückwirkend zu einer bloß approximativen Schätzzahl degradierten und noch vor Baubeginn robuste 250 Millionen Euro mehr verlangten – und vom Haushaltsausschuss auch schulterzuckend genehmigt bekamen. Wenn ähnlich prominente Architekten wie in Hamburg eine leuchtende Hafenoper an den Main stellen sollen, muss die veranschlagte Summe von 809 Millionen Euro für zwei neue Häuser, eine Interimsbühne und ein Produktionszentrum nicht das letzte Wort sein (die Elbphilharmonie allein kostete deutlich mehr). Doch es geht beim Frankfurter Bühnenstreit nicht nur ums Geld. Was kaum diskutiert wird, ist die Axiomatik jener Kategorien und Begriffe, mit denen der Prüfbericht argumentiert.
Dass eine Sanierung „nicht nachhaltig“ sei, wie es in der Pressemitteilung der Stadt heißt, bedeutet nicht, dass Neubauten nachhaltiger wären. Während alle Welt betont, wie wichtig es Die „Theaterdoppelanlage“ am Willy-Brandt-Platz angesichts der verheerenden CO2-Bilanz von Neubauten wäre, den Bestand schonend zu sanieren, werden solche Sanierungen durch die aktuellen Bauvorgaben, vor allem durch absurde Dämm- und Komforterwartungen, quasi unmöglich gemacht. Noch interessanter ist die Formulierung, nur Neubauten würden den „Stand der Technik“ erfüllen und einen „zukunftsfähigen Betrieb“ ermöglichen. Wer definiert jenseits baurechtlicher Vorgaben diesen Stand, wer, was „zukunftsfähig“ ist? Im 20. Jahrhundert wurde die Qualität eines Theaterbaus oft durch technische Gadgets, durch die Zahl der Drehbühnen und anderes technisches Überwältigungstheater bestimmt; wer bestimmte Effektapparaturen nicht bieten konnte, wurde so mitleidig angeschaut, als würde er mit dem Automodell vom Vorjahr auf den Firmenparkplatz rollen.
Es ist auch diese letztlich konsumistische Definition von „internationalen Standards“, die die großen Theater immer mehr wie überdimensionierte, sämtliche Ressourcen fröhlich zerdieselnde Kreuzfahrtschiffe aussehen lässt. Ob sie die aktuellen Nachhaltigkeitsdebatten überlebt, ist noch die Frage, zumal die ölscheichhafte Spendabilität der öffentlichen Hand sich nach der Baufertigstellung beim Betrieb dieser Häuser meist nicht fortsetzt: In den babylonischen Berliner Kulturbauten haben Kuratorinnen und Kuratoren mit kargen Ausstellungsetats, untertariflichen Hungerlöhnen und prekären Arbeitsverhältnissen zu kämpfen – und auch die Gehälter für Schauspieler, das Geld für die Ensembles und den Betrieb der großen Theater stehen meist in keinem Verhältnis zu den Phantasiesummen, die für ihren Bau losgeeist werden.
Ganz einfache Konstruktionen
Es ist gut, wenn sich eine Gesellschaft Kulturbauten viel kosten lässt, denn es sind am Ende diese Bauten, in und vor denen diese Gesellschaft im Wortsinn statt findet. Aber wie viel Techno-Luxus muss wirklich sein? Die Behauptung, bestimmte Künstler würden nicht nach Frankfurt kommen, wenn man dort keine Aufführungen „auf dem neuesten Stand“ machen könne, offenbart letztlich einen phantasielosen Gehorsam gegenüber dem Imperativ einer Innovationskultur, für die Fortschritt vor allem spektakulärer Budenzauber bedeutet. Dass Theater besonders dann gut sein kann, wenn es sich auf die Schauspieler konzentriert und nicht aufs große Effekt-Georgel, kann man zurzeit in Bochum an Johan Simons „Iwanow“ sehen.
In der ganzen Debatte, bei der die Hundertmillionen-Einheiten wie bei einem verrückten Monopolyspiel hin- und hergeschoben werden, wird fast vergessen, dass jene neuen Bühnen, die in der Architekturwelt gerade am meisten diskutiert werden, weil sie ganze Stadtteile wiederbeleben und verzaubern, ganz einfache Konstruktionen sind wie die Holzbauten und die zu Kinos und Bühnen umgebauten Tankstellen, die das Londoner Architekten-Kollektiv Assemble entwarf, oder auch das geniale Aufklapptheater von Matthew Mazzotta, das im nordamerikanischen Lyons ein totes Kleinstädtchen mit wenigen Griffen wiederbelebt: Die Fassade klappt weg, eine Tribüne rollt auf den Bürgersteig und verwandelt prompt die ganze Straße in eine Bühne.
Ja, natürlich: So kann man keine Oper bauen und kein Theater für Tausende. Andererseits erinnern gerade diese Beispiele daran, wie effektvoll ein Theater sein kann, das sich vor allem auf das Einmalige dieser Kunstform, die menschliche Präsenz auf der Bühne, konzentriert. Die gefeierten neuen Low-Budget-Theater markieren das andere Ende einer Bühnenbaukunst, die das Improvisierte als Befreiung und nicht als Einschränkung empfindet und die Schauspieler nicht gegen den Bombast von Räumen und Inszenierungen anspielen lässt, die ihre Vorbilder im Überwältigungstheater von Oscarverleihungen und Katzenmusicals suchen.
Vieles von der Leichtigkeit der neuen, kleineren Arte-Povera-Theater scheint in den Entwürfen der Kasseler und Hamburger Studentinnen und Studenten für den Interimsbau durch, der so oder so in Frankfurt gebaut werden muss; er steht in ihren Skizzen mit einer selbstverständlichen Eleganz und Offenheit auf dem Goetheplatz oder an anderen Orten der Stadt. Es wäre keine Überraschung, wenn am Ende dieser temporäre Bau dem Spiel mehr Luft gäbe als die Milliardentanker, von denen die Stadt im Namen einer begründungsbedürftigen Idee von „neuestem Stand der Technik“ träumt.
Publikation mit freundlicher Genehmigung von Niklas Maak