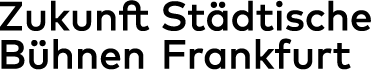hier als download, beschlossen am 12.7.2023
Symposion „Die Zukunft der Theater-Doppelanlage“
Im Januar 2020 beschloss die Frankfurter Stadtverordnetenversammlung den Abriss und Neubau der Theaterdoppelanlage am Willy-
Brandt-Platz. Seit diesem Beschluss gibt es keine weiterführenden politischen Entscheidungen zur städtebaulichen und architektonischen
Zukunft von Schauspiel/Kammerspiel und Oper. Stattdessen werden in loser Folge verschiedene mögliche Standorte und Kubaturen vorgestellt.
Entscheidet man sich für die sogenannte Spiegellösung, also die Aufteilung in zwei Häuser, für ein Haus unterhalb eines neuen Hochhauses
an der Neuen Mainzer Straße oder für eine Kulturmeile in der Wallanlage. Oder womöglich doch für den Erhalt des Hauses und einer
sinnfälligen und sinnstiftenden Sanierung. Die Stiftung hatte namhafte ReferentInnen eingeladen, um die Argumente auszutauschen und der
Frankfurter Stadtgesellschaft darzulegen, welche Lösung oder welche Lösungen die nachhaltigsten sind oder sein könnten.
Videodokumentation der Veranstaltung
Eine textliche Zusammenfassung der Veranstaltung findet sich hier: https://urbanfutureforum.org/stadtpolitisches-symposium-die-zukunft-der-theater-doppelanlage
Programm:
Einführung: Prof. Helmut Kleine-Kraneburg
Impulsvortrag: Astrid Wuttke
Podiumsgespräch
ReferentInnen:
Julia Frank, Planungs- und Bildungspolitische Sprecherin Die Grünen
Andrea Jürges, Architektin und Vize-Direktorin DAM
Dr. Albrecht Kochsiek, Planungspolitischer Sprecher CDU
Astrid Wuttke, Geschäftsführende Gesellschafterin
schneider + schumacher Weiterbauen GmbH
Olaf Winter, Technischer Direktor Oper Frankfurt
Moderation:
Jens Jakob Happ, Architekt und Stadtplaner, Frankfurt am Main
Prof. Helmut Kleine-Kraneburg, Architekt, Frankfurt am Main
Eine Veranstaltung des urban future forum
Untermainkai 40, 60329 Frankfurt am Main
www. urbanfutureforum.org
Luft nach oben…
Gedanken zur Zukunft der Städtischen Bühnen
von Peter Lieser
Wenn die Dinge klar laufen, bin ich ein friedlicher Zeitungsleser. Doch Ende Februar, mitten im Oberbürgermeister-Wahlkampf in Frankfurt am Main, packte mich die Wut als ich las, dass die Kulturdezernentin der Stadt (SPD) aus heiterem Himmel Untersuchungsergebnisse ihrer Stabsstelle aus deren Bericht „Ergänzende Prüfaufträge zur Zukunft der Städtischen Bühnen“ vorstellte. Wahlkampf?
Fazit: Die Variante „Kulturmeile“ ist zu teuer, weil die Frankfurter Sparkasse normales Geld für ihr Grundstück möchte, was sich vorher alle Beteiligten an ihren fünf Fingern abzählen konnten. 50 Mio.€ pro Finger, geschätzter Wert?
Also: gestorben. Variante „Neubau Doppelanlage“ eingeschränkt tauglich, mit ihren Interimslösungen zu teuer, schwer zu steuern und zu langwierig.
Also: gestorben, in Vorbereitung.
Variante „Spiegellösung“ in allen untersuchten Themenfeldern der Favorit, selbst beim behaupteten Zugewinn von Grün und der Grünnutzung.
Auch der Vorsitzende des Städtebaubeirates klatschte Beifall.
Werde ich in dieser Stadt noch zum Wutbürger? Dachte ich, las aber weiter, dass nun endlich, nach 15 Jahren Entscheidungsvakuum innerhalb der Stadtregierung (seit klar ist, dass die Städtischen Bühnen ein existenzielles Sanierungs-Problem haben), die Bürgerbeteiligung eine große Rolle spielen soll.
Aufschreiben, sagen was drückt.
Hilft das, wenn man gegen die zahlreichen Abriss-Argumente für das „bestuntersuchte“ Haus der Republik („überuntersucht“ heißt es in einem kritischen Text) anschreiben muss?
Anschreiben gegen die mehr als zahlreichen Meinungen von Fachleuten der betreffenden Branchen, Gutachtern, Stabsstellen und die unterschiedlichen Interessen vieler Parteien und Politiker in Frankfurt?
Es fällt auf, dass die inhaltlichen Stimmen aus der Welt des Theaters in diesem „Adagissimo ma non troppo-Konzert“ fehlen, wenn man von den eindringlich warnenden Stimmen vor dem Kollaps der für die Bühnen Tätigen absieht.
Nein, es gab schon viele seriöse Stimmen für das Neu- und Weiterbauen der Doppelanlage, die nicht zu einem konstruktiven Dialog über die inhaltliche Zukunft des Theaters und zu einem internationalen Ideenwettbewerb über den Standort am Willy-Brandt-Platz führten, der längstens entschieden wäre.
Will man bisher nicht sehen was baulich am Ort möglich ist und was weltweit die Tendenzen im Theater sind?
Soll eine Stabsstelle, so weisungsgebunden korrekt sie ihre Aufträge auch erfüllt, gegen den genialsten Standort in der Stadt, den es bereits gibt, entscheiden?
Und nochmals nein – und doch kam es leider anders.
Wir erinnern uns an einen Tag im Sommerloch 2020, als plötzlich professionelle farbige Pläne von einer Neuen Oper auf einem Grundstück der Frankfurter Sparkasse auftauchten, vorgestellt von der Kulturdezernentin, Ideengeberin in Zusammenarbeit mit dem Stadtplanungsdezernenten und SPD-OB-Kandidaten.
Kulturmeile, Aufwertung der Wallanlage, städtebauliche Verbesserung im Quartier der Bankenklamm waren plötzlich Zauberwörter für ein Viertel im spekulativen Stillstand der Finanzbranche.
Braucht es wirklich eine Neue Oper in Milliardenformat, um hier, mitten in der Bankenwelt, für städtebauliche Bewegung zu sorgen?
Bedarf es eines neuen Opernhauses, um eine Kulturmeile zu bewerben, die bereits existiert (Alte Oper, Städtische Bühnen, English Theatre) und, wie schon geschehen, mit punktuellen Ergänzungen (MMK-Dependence), gestärkt würde?
Hätte nach diesem Muster nicht auch die Zeil (im spekulativen Stillstand der Handelswelt) das Label einer „Kulturmeile“ verdient, vom Zoo (Naturkultur, Kindertheater) bis zum Bahnhof (Industriekultur), wenn dort anstelle von Karstadt ein neues Theater entstehen würde, und alle möglichen Kultureinrichtungen entlang dieser Mall bei entsprechender Suche sich hierzu finden lassen würden? Doch wohl nicht im Ernst…
Stattdessen also Kulturmeile im Bankenviertel, Bauen ohne Grundstück.
Seriöse Verhandlungen mit dem Grundbesitzer Sparkasse wurden versprochen. Bekannt waren die Bauabsichten der gleichen Eigner auf dem Nachbar-Grundstück. Und zwischen den Zeilen einiger Verlautbarungen lasen sich mögliche erhöhte Höhenrechte heraus. Ein Koppelgeschäft? Verbietet sich jedoch im städtischen Handeln, und vermutlich konnte dieser Deal auch deshalb nicht gelingen.
Mehr als zwei Jahre hielt das mit großen Bildern aufgemachte Versprechen, die Neue Oper im Bankenviertel zu bauen. Viele Leute fanden die „Sparschweinoper“ (Volksmund) richtig gut, moderner Style und unabhängig dastehend wie ein Monoblocco, und doch schön eingequetscht zwischen Bankenklamm und Wallanlage, mit Zugang von dort und Blick in die auf Gartengröße zurecht gemähte, doch denkmalgeschützte Traditionsanlage.
Auch hier applaudierte der Vorsitzende des Städtebaubeirats, während ein bekannter Frankfurter Architekt öffentlich kommentierte, dass die Bankenklamm sich eher für den Bau einer schnelllebigen Autobahn-Raststätte eigne, als für ein Jahrhundertprojekt wie eine Neue Oper.
Und dann, in Zeiten des Wahlkampfes gescheitert? Die Spiegellösung, 2020 als Interim-Bauwerk vorgeschlagen von der Umwelt-Dezernentin (Grüne) und jetzt statt Kulturmeile als Erfolgsprojekt der SPD präsentiert? Während der CDU-OB-Kandidat an der Standorteignung für eine Raststätte seriös festhält?
Die Kulturmeile mit Neuer Oper fällt auf der Pressekonferenz Ende Februar 2023 um wie ein Kartenhaus. Zweieinhalb Jahre im Sinne der maroden Doppelanlage mit über 1000 Tätigen so einfach mal verloren und verschenkt.
Und dazu propagiert, postwendend sekundierend, eine SPD-Stadtverordnete statt Kulturmeile nun ein Kulturdreieck und findet das auch noch interessant.
Zwei Bauwerke, schon wieder in animierten Farbfotos und sogar in Einsatz-Modellen werden präsentiert, das Neue Schauspiel raumfüllend in der „oberen Lage“ der Wallanlage. Diese laut Wallservitut freizuhaltende obere Lage wurde bereits mehrfach zum Ort des Sündenfalls der Überbauung. Unter anderen wurden 1880 die Frankfurter Oper und 1902 das Frankfurter Schauspiel dort errichtet.
Der Willy-Brandt-Platz soll durch zwei schräg gegenüberstehende Bauwerke, ein Schauspiel und eine Oper, städtebaulich wohl gestaltet werden? Geht es noch schräger? Statt dass das Grün an dieser Stelle der Wallanlage dezimiert und geschädigt wird, soll vorgeblich Grün vermehrt und aufgewertet werden?
Hat denn die Wallanlage, über ihre Tradition und Geschichte, über ihre Ästhetik und über ihre Bedeutung in der großstädtischen Ökologie hinaus, denn keine sozialen und städtebaulichen Qualitäten? Stattdessen nur einen Wert als Baulandreserve für die öffentliche Hand?
Was soll man von der jetzt favorisierten Variante „Spiegellösung“ nun wirklich halten? Dass sie nach weiteren zweieinhalb Jahren wieder umfällt wie ein Kartenhaus? Oder wäre es nun endlich an der Zeit in den Spiegel zu schauen?
Standort
Falls die Oper, wie einige Volksvertreter und Bürger es mit Verweis auf Sydney träumten, am Wasser hätte gebaut werden sollen, gab es nur einen passenden Standort in privater Hand: Degussa nebenan? Waren es die hohen Grundstückskosten, die wie in der Bankenklamm zum Aus führten, oder kam, als das Grundstück zu haben war, niemand auf die Idee, ein Tauschgeschäft und ein schnelles Neu-Bauen der Doppelanlage ohne Interim vorzuschlagen? Fehlte die Weitsicht? Ok, Sydney war gestern…
Zahlreiche Standorte sind untersucht worden, zwei sind geblieben. An Ausdauer, Erfindungsreichtum, Fleiß und Spürsinn der Stabsstelle hat es nicht gefehlt. Doch war nicht schon vor 15 Jahren klar, dass es nur einen einzigen passenden Standort und den obendrein in städtischem Besitz gibt? Den, auf dem die jetzigen Bühnen stehen und arbeiten, große Erfolge und Ehrungen erringen?
Hat jemand aus der Stadtregierung, oder hat jemals die Stadtverordneten-Versammlung laut und deutlich und vor allem öffentlich gesagt: Wir nehmen die Probleme unserer Bühnen ernst und fest in die Hand, ich will, wir wollen, dass die städtischen Bühnen auf alle Zukunft an dieser Stelle ihren Ort in unserer Stadt haben? Leider nein.
Dann wäre vor 15 Jahren schon der Standort klar gewesen. Heißt: Der jetzige!
Und dafür gibt es auch gute Gründe, die neben den schon immer wieder ausführlich benannten wie Citylage, Erschließung, historische Bausubstanz, Denkmalaspekte und anderen wichtig sind.
Die Frankfurter Oper von 1880 und das Frankfurter Schauspiel von 1902 sind mit Bedacht als freigestellte Baukörper entstanden. An oder nahe von städtebaulichen Achsen platziert, die für die Entwicklung Frankfurts bedeutsam waren: Die Bockenheimer Landstraße als Verbindung der Altstadt mit dem neuen Stadtteil Westend. Die Braubach-/Münchnerstraße und die Zeil/ Kaiserstraße als Verbindung mit dem neuen Bahnhofviertel und Hauptbahnhof.
Darüber hinaus waren die geschaffenen Platzsituationen, davor und umgebend, städtebaulich prägend und für den repräsentativen Wert der beiden Gebäude sowohl selbstverständlich als auch unverzichtbar.
Dazu kam, dass klare Vorder- und Rückfronten im Sinne der Funktion (Publikum und Betrieb) definiert wurden und dass dieses Vorne und Hinten städtebauliche Auswirkungen auf das direkte Umfeld hatte. Die Wirkungen kann man auch heute noch hinter der Alten Oper – Bockenheimer Anlage – und hinter der Doppelanlage (mit dem umbauten ehemaligen Schauspiel im westlichen Teil) in der Hofstraße erkennen.
Und nun – allen Erfahrungen zum Trotz – mit einer „Spiegellösung“ ein neues Schauspiel mit seiner Front zum Willy-Brandt-Platz bauen zu wollen, das sein Hinten der Kaiserstraße zuwendet, ist wirklich nicht verstehbar.
Die Oper von 1880 an ihrem jetzigen Standort wurde erst ermöglicht durch ein Tauschgeschäft, das die damalige Handelskammer weitsichtig initiiert hatte. Die Oper sollte ursprünglich am Rahmhof, in die Nähe des damaligen Schauspiels, dicht umstanden von Häusern, platziert werden. Nach dem Tauschgeschäft fügten sich Börse und Handelskammer dort ein. Auch diese Seite des Flächentausches war städtebaulich angemessen, wie man heute noch am Standort Börsenplatz, dem Sitz von Börse und Industrie- und Handelskammer sehen kann. Ein Vorgang also in der Frankfurter Stadtentwicklung, der von einer wirkungsvollen Teilhabe von privaten Akteuren, die sich, jenseits der herrschenden Politik, der gesellschaftlichen Bedeutung eines freien Standortes der Oper sicher waren, Zeugnis ablegt.
Natürlich sind durch die (Alte) Oper und das (alte) Schauspiel der Wallanlage große und wertvolle Flächen entnommen worden und damit Schäden entstanden. Aber man muss die Schädigung heute und endgültig nicht wiederholen. In diesem Sinne sollte die Wallservitut verändert werden, falls sich eine Mehrheit im Römer findet, die aus der Ausnahmeregelung „Bebauung im öffentlichen Interesse“ (was als Baulandreserve für die Stadt Frankfurt ausgelegt werden kann) eine strikte Verbotsregelung macht.
Bemerkenswert und vorbildlich in diesem Zusammenhang ist auch der Umgang mit dem Schauspiel von 1902, das wie die Oper, in der gleichen Bombennacht von 1944 zur Ruine wurde. Aus dem Schauspiel wurde mit dem mutigen Beschluss von 1949 das „Große Haus“, das – an Weihnachten 1951 eingeweiht – Schauspiel und Oper unter einem Dach vereinte.
Die für Opernhäuser zeitgemäßen Seiten- und Hinterbühnen (Kreuzgrundriss) wurden zur Schonung der (restlichen) Wallanlage nicht angebaut.
Stattdessen erfand und konstruierte man eine Drehbühne, in die eine zweite, knapp halb so große eingelassen war, gelagert auf einer ausgedienten Geschützlafette, die mit einem Durchmesser von knapp 38 Metern den legendären Ruf der größten Drehbühne Europas bekam.
Wo lässt sich heute, nach Präsentation der Spiegellösung, die Achtung vor der Bedeutung der Wallanlagen erkennen?
Interim
Mit einem klaren Beschluss zum Verbleib der Doppelanlage am jetzigen Standort (der seit Bekanntwerden einer notwendigen und umfassenden Sanierung im Jahre 2008 nicht gefasst wurde) wäre auch die Erweiterung des Beschlusses auf eine Suche nach bespielbaren Interims-Orten die logistische Folge gewesen: „Stabsstelle Interim“.
Man stelle sich vor, statt Standortsuche mit jahrelang immer wiederkehrenden Parametern und ähnlichen Ergebnissen, die zwangsweise zurück zum alten Standort führen, weil es nur diesen einen geeigneten gibt, hätten die Bearbeiter ganz Frankfurt nach Theater-geeigneten Räumen durchsuchen dürfen. Gemeinsam mit den Städtischen Bühnen.
Inspiriert von dem Gedanken, ein Jahrhundertprojekt „Neue Städtische Bühnen und andere Aktivitäten“ am Willy-Brandt-Platz vorzubereiten und zu ermöglichen. Und beseelt von der Idee, die Theaterwelt in bisher für das Theater nicht erschlossene Frankfurter Welten zu tragen.
Ich komme hier bewusst nicht zurück auf den Vorschlag des damaligen CDU-Stadtkämmerers, der zur Linderung der Not nach dem Brand der Oper im November 1987 das Schauspiel zur Wanderschaft durch die Bürgerhäuser animieren wollte, um zehn Millionen DM für den Umbau des Bockenheimer Depots zu sparen.
Interim-Theater kostet Geld, sei es im Betrieb von Spielstätten, in der Herrichtung oder, wenn es sein muss, auch im modularen Neubau, der nach Erstnutzung weitere Folgenutzungen finden kann. Etwa auf dem lange erwarteten Kulturcampus. Rechnet sich aber auch durch unerwartete soziale und künstlerische Effekte, und führt manchmal (wie aktuell bei der wohlgelungenen, nur 43 Mio. Euro teuren Interim-Konzerthalle München für die Zeit des Umbaus des Konzerthauses im Stadtteil Gasteig) zu überraschenden Überlegungen nach Dauerbetrieb und Erhalt.
Ich erwähne hier das Beispiel des Umbaus der Oper Bruxelles „La Monnaie/De Munt“ (Aufstockung des altehrwürdigen Haupthauses und Bühnenturms, Verbesserung von Technik und Sicherheit) mit Steuerung von ganz oben (Belgisches Ministerium), kalkulierter und eingehaltener Umbauzeit von ambitionierten drei Jahren (1984 bis 1986). Oper, Musik und Tanz fanden auf Tourneen, in einer alten Markthalle, in einem Zirkuszelt solch angemessene Spielstätten, dass „La Monnaie“ bereits zwei Jahre nach Wiederaufnahme des Theaterbetriebes, in einem Feature im Juni 1988 von zwei Autoren des Hessischen Rundfunks als bestes Haus in Europa bezeichnet werden konnte.
Einer von beiden war der heutige Intendant der Frankfurter Oper, der aus dieser Zeit seines Wirkens weiß, dass eine Interimssituation kein aufwendiges neues Bauwerk mit Drehbühne braucht, um den Ruf zu halten und die Reputation, die er sich und der Oper Frankfurt erarbeitet hat.
In Bruxelles war es kein anderer als Gérard Mortier, der das Haus als Künstlerischer Direktor durch diese erfolgreiche Umbauphase geführt hat.
Heißt mit anderen Worten: Es kommt auch auf Personen an, die „Erfindung und Improvisation“ zu einer neuen künstlerischen Ästhetik formen. Wäre das nicht auch in Frankfurt ein Anreiz, ein Interim-Theater zu wagen?
Frankfurt hat Erfahrung mit Interim. Und langen, einher laufenden Diskussionen. Doch nach dem Opern-Brand im November 1987 kamen die zuständigen Entscheider der Stadtregierung sehr schnell überein, das Haus an gleicher Stelle wieder aufzubauen, in einigen Details vergrößert und verbessert. Stadtverordnete reisten nach Bruxelles, um den Erfolg des dortigen Umbaus der Oper zu besichtigen, während sich in Frankfurt alle Parteien mit Ideen von Umbau und Neubau überboten – damals wie heute fast alltäglich.
Ist der nach dem Brand von 1987 eilig präsentierte Entwurf eines bekannten Frankfurter Architekten, den die FDP hochlobte, noch in Erinnerung? Zwei ordentlich hohe Hochhäuser an der Neuen Mainzer Straße und dazwischen eine Oper, ein Schauspiel an der Friedberger Anlage in den Wallanlagen? Selbst der damalige SPD-OB-Kandidat war beeindruckt und forderte seine Partei zum Nachdenken auf.
Für das Schauspiel, das den Brand unbeschädigt überstanden hatte, wurde nach einigen Budget- und Zuständigkeitskonflikten das Bockenheimer Depot im Eiltempo hergerichtet, für eine Summe, die heute bescheiden anmutet. Das Depot hatte schon, trotz aller Gegenargumente wie Baufälligkeit, Technik- und Raumbeschränkung, Lage außerhalb der City und Zuständigkeit der Universität (des Landes Hessen), seine wunderbare Eignung durch vielbeachtete und -besprochene Inszenierungen externer Theatermacher und Festival-Produktionen unter Beweis gestellt. Lob gab es immer, von allen Seiten und gerade auch von außen. Tadel gab es immer an der Stadt und an dem Land, dieses einmalige Industriedenkmal verrotten zu lassen.
Das Schauspiel konnte, nach einigen Durststrecken der Doppelbelegung des vorübergehend umbenannten „Großen Hauses“ (der unversehrten Bühne) gemeinsam mit der Oper, bereits im darauffolgenden Oktober 1988 das Depot als feste Interim-Spielstätte übernehmen und brachte dort, trotz fehlender, üblicher Bühnentechnik vielbeachtete Produktionen auf die variable Bühne, vor einem in der Anordnung variablen und in der Rezeption sichtlich begeisterten Auditorium.
Es sei daran erinnert, dass das Depot nach Wiederbezug der hergestellten Doppelanlage am Willy-Brandt-Platz zur festen Spielstätte des William Forsythe-Tanzensembles wurde, und – bis heute – zahlreiche glanzvolle Produktionen (vom Einar-Schleef-Theater bis zum Musiktheater Heiner Goebbels und des Ensemble Modern, und anderen renommierten Gästen) ermöglicht.
Interim-Nutzung als Rettung und Ertüchtigung, als „Erfindung“ von Raum?
Vielleicht ist es im Laufe der Zeit in Vergessenheit geraten, dass auch die – sofort nach dem Brand solidarische – Alte Oper für einige Produktionen der abgebrannten Oper als Interim-Spielstätte diente? Ich erinnere mich an sehr eigenwillig-schöne Bühnenbauten, die „Elektra“ (Einakter von Richard Strauss) in und über das Publikum führte, an konzertante Aufführungen von Aida, Cosi fan tutte, Parsifal etc. unter Gary Bertini, ich erinnere mich an Berichte über sehr erfolgreiche Tourneen der Oper, etwa nach Israel.
Warum nicht heute, im Falle einer notwendigen Interimszeit, die bereits mehrmalige „Deutsche Oper des Jahres“ in die Welt führen, etwa nach Kiew? Auch das könnte „Interim“ bedeuten.
Die Stadt Köln wird häufig für die Sanierung ihrer Doppelanlage am Appellhof-Platz gescholten, insbesondere für die lange Überziehung der Umbau-Zeitdauer und für die davonlaufende Überziehung der Sanierungskosten.
Aber: Nach bitteren Erfahrungen informiert Köln mittlerweile regelmäßig und transparent über den Umbau und hat seine Interimslösungen gefunden:
Die Oper spielt in der Messe (was allgemein als zu weit entfernt von der City und zu nüchtern vom Ambiente her erlebt wird), und das Schauspiel hat seine Übergangs-Spielstätte in einer Industriehalle (auch rechtsrheinisch) bezogen, die mittlerweile sehr angenommen und beliebt ist. Auch wenn nicht alles passt wie in einer angestammten Theaterwelt – kann man nicht von Kölns Beispiel, im Negativen wie im Positiven, lernen?
Depot, Naxos, obsolete Hallen im Industrie- und Hafengebiet Ost, falls sie sich finden lassen, Alte Oper, Jahrhunderthalle Höchst, Frankfurter Festhalle und Messehallen mit einem auf dem Messegelände zu errichtenden „Produktions-Zentrum“ (Werkstätten, Proben- und Einspielräume für beide Bühnen) könnten – aus meiner ersten Sicht – Spielstätten für den Übergang sein. Eine „Stabsstelle Interim“ würde nach tiefer Recherche reichhaltigere Findungen präsentieren, auswählen, anmieten und für den Theaterbetrieb ertüchtigen. Lässt sich das alles nicht in planbarer Zeit machen?
Für eine begrenzte Zeitdauer, unter der gemeinsamen Motivation aller Beteiligten, ein Experiment zu wagen, das neue Wege des Theaters zeigt, das Publikum mitnimmt und – zeitlich stringent – zu einem in Wert gesetzten Gebäude am Willy-Brand-Platz führt? Ein Theater, das ein einmaliges Format für das nächste Jahrhundert hat und alle Beteiligten sagen lässt:
„Frankfurt am Main kann Interim“.
Theater der Zukunft
In meiner Sicht auf Frankfurt und seine Kultur fehlt das nachhaltige Gespräch und Nachdenken über die inhaltliche Entwicklung des Theaters.
Der Eindruck herrscht vor, dass es bisher nur um Standort und Geld geht. Und weiter: es fehlt die Leidenschaft für das Theater, die große Neugier für das was Theater ist und das was kommt.
Dabei gibt es in der Welt so viele verschiedene Formate und Orte zu sehen und zu bewundern, unter denen und in denen Theater produziert wird. Feste und offene Ensembles, an festen und offenen Orten, Festspiele an etablierten und elitären Spielorten, Festivals in Regionen und Städten, die im Strukturwandel sind und dabei mithelfen, aus Krisen herauszufinden. Spielstätten, temporär errichtet und danach mit Erfolg dauerhaft betrieben. Private und öffentliche Investitionen in umgenutzte Industrie-Hallen und Gebäude, in leerstehende Kirchen und Klöster, Theater-Spielstätten ohne Ensemble, die Sparten-übergreifende Experimente und internationale Co-Produktionen ermöglichen und mit ihren überraschenden, eigenwilligen Inszenierungen auf Festival-Tourneen gehen. Darüber hinaus ist es so, dass die technischen Ausstattungen von Spielorten immer mehr in die Nähe der bewegten Bilder tendieren, Film und digitale Medien – und auch raumbildendes Licht – scheinen die Bühnen und Inszenierungen, auch die Musik auf den Bühnen und in den Konzerthäusern um Dimensionen zu erweitern.
Klingende Namen, nur um einige zu nennen: Aix-en-Provence, Arles, Avignon, Paris, Edinburgh, Graz, Lausanne, Salzburg, Ruhrtriennale, Mailand, Oslo – Hallentheater und Guckkastenbühnen darunter – Vielfalt rundum.
Natürlich gibt es in Frankfurt verschiedene Theater-Formate, zwischen etabliertem en-suite-Repertoire an großen, mit Budget, Ensemble und Technik gut ausgestatteten Bühnen und einer reichhaltigen, sich stets verändernden off-Theaterkultur. Und diese sollen um ein, bereits länger als zehn Jahre erwartetes, synergetisches Projekt „Kulturcampus“, mit der Umsiedlung der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst als Frankfurter Ausbildungsstätte für Musik, Theater und Tanz und mit der Schaffung von Raum für experimentelle Musik und Theater bereichert werden.
Stellt sich nicht – auch schon seit langer Zeit – die Frage, ob nicht, vor den Investitionen in ein Milliardenprojekt für Frankfurt, die erfahrensten Fachleute, weltweit geschaut und auch hier am Ort zuhause, darüber beraten sollten, wie die Zukunft des Theaters, der Sparten die sich darunter entfalten wie Oper, Balett, Operette, Musiktheater, Tanz, Schauspiel, Musik, Literatur, Neue Medien und andere mehr, aussieht und sich entwickeln kann und wird?
Ob in Frankfurt die Sparten getrennt werden oder vereint bleiben sollen?
Neue hinzukommen?
Und wie ein Zusammenwirken von zwei ambitionierten Großprojekten – Städtische Bühnen und Kulturcampus – in dieser kleinen Großstadt kreativ-synergetisch stattfinden und letztendlich auch finanziert werden kann?
Dies sollte, nach entsprechender Vorbereitung, schon sehr bald stattfinden, um nicht noch mehr Zeit zu verlieren und um die inhaltliche Basis für einen architektonischen Ideen-Wettbewerb zum Umbau, Weiterbau und Neubau der Städtischen Bühnen noch in diesem Jahr legen zu können.
Luft nach oben
Könnte ein Beschluss zum Thema „Bauliche Gestalt“ etwa lauten:
„Wir wollen, dass die besten Architekten uns in einem internationalen Ideenwettbewerb zeigen, wie die zukünftigen Bühnen, auf der erarbeiteten Grundlage über die Zukunft des Theaters und unserer gesellschaftlichen Labore, aussehen, unter Wahrung der historischen Werte der jetzigen Bauten und unter Schaffung einer Ästhetik von Frankfurter Charakteristik, Form und Inhalt der zukünftigen Anlage am jetzigen Ort“?
Auch hier wäre es an der Zeit, sich die Bilder von Experten aus Frankfurt und der Welt zu holen, um das zu sehen, was zwischen Willy-Brandt-Platz und Hofstraße, zwischen Neue Mainzer Straße und Gallus-Anlage architektonisch möglich ist. Wenn man alle bisher gemachten Vorschläge aus der lokalen Architektenwelt, auch diejenigen zum Wolkenfoyer und zu den historischen Teilen des ehemaligen Schauspiels und alle Untersuchungen der Stabsstelle zusammennimmt und das noch zu erarbeitende inhaltliche Wissen zur Entwicklung des Theaters allgemein als Basis für einen Theaterbau hinzunimmt, könnte eine Ausschreibung eines internationalen Wettbewerbes noch in diesem Jahr gelingen.
Auch gibt es die wunderbare, vom Deutschen Architektur Museum herausgegebene Sammlung von Beispielen im Theater- und Konzerthaus-Umbau, -Weiterbau, -Neubau in Europa, aus dem sich zahlreiche Anregungen zu Nutzungen über das jetzige, ausschließliche Theaterwesen der Städtischen Bühnen hinaus gewinnen lassen. Es gibt viele Forderungen nach einem Mehr an öffentlicher Teilhabe (Bibliothek, Theaterarchive, Zentrum für bewegte Bilder etc.) und städtebaulichem Leben in der Sockelzone und auf begehbaren Dachterrassen (Gastronomie, hängende Gärten etc.) an einem solch großen öffentlichen Gebäude im Innenstadtbereich. Es gibt technische Entwicklungen der Energieeinsparung und -gewinnung auf Dächern und an Fassaden und der Ressourcenschonung im Innern. Und das bedeutet Raum- und Flächenzuwachs, weit über das jetzt schon vorhandene, viel zu knappe Potenzial hinaus.
Drei Beispiele, die für den Umbau, Weiter- und Neubau der bestehenden Frankfurter Theater-Doppelanlage interessant sein können, hier skizziert:
Lyon:
In der oben erwähnten Sammlung zeigt die „Opéra de Lyon“ (und der Umbau-Siegerentwurf von Jean Nouvel) durch Vertiefung und Aufstockung von je 20 Metern, bei Erhalt der alten, klassizistischen Fassaden, wie es gelingen kann, beachtlich großen Raum für Technik, Probenräume, einen zusätzlichen Raum für experimentelle Formate zu schaffen und ein öffentliches Sockelgeschoss „Arkaden“ hinzu zu gewinnen. Und obendrein, durch die weit sichtbare Aufstockung, einen „Leuchtturm“ am oberen Ende des UNESCO-Weltkulturerbes „Presqu`île“ zu errichten. Umbauzeit fünf Jahre (1989 – 1993).
Bruxelles:
Die Aufstockung um zwei Großgeschosse von Haupthaus und Bühnenturm sowie die Neuausstattung mit Technik und Sicherheit der Brüsseler Oper wurden bereits angesprochen. Das Haupthaus aus dem 19. Jahrhundert, mit seinen fünf prunkvollen Logen-Galerien, seinem Deckengemälde und zahlreichen Kunstschätzen, wurde, ohne Schaden anzurichten, mit Beton ummantelt und erhöht, der Bühnenturm aus Beton neu eingebaut und zeitgemäß auf eine moderne Schnürboden-Technikhöhe gebracht. Die Besonderheit während der Interimszeit war das sehr beliebte „Hallentheater“ in der ehemaligen Markthalle des dichten und durchmischtem Stadtteils Schaerbeek. Die Halle hat sich dadurch von einer provisorischen Autogarage zu einem renommierten und sehr frequentierten Kulturzentrum entwickelt.
Genua:
Nach mehreren Anläufen mit Wettbewerben und Überarbeitungen von Siegerentwürfen wurde das durch Kriegsschäden stillgelegte „Teatro Carlo Felice“ in Genua von Aldo Rossi wiederaufgebaut und – insbesondere im Innern – umgestaltet. Der Bühnenturm, und das ist aus Frankfurter Sicht das Besondere, ist sehr kompakt, war in den unteren Teilen erhalten, und ist von seinem Architekten als neues Wahrzeichen der Hafenstadt Genua – weit sichtbar vom Meer aus – gestaltet worden. Ein Genueser Turm mit dorischem Ausdruck, der Ruhe und Stärke vermittelt und mit einem Kranzgesims, wie üblich bei Genueser Türmen, in dem sich viel Technik verbirgt (in der Fachliteratur als „Technologischer Heiligenschein“ tituliert). Der aufgestockte Turm erweiterte den Raumbedarf für die zeitgemäße Unterbringung von Technik und deckte den zu Zeiten der Einweihung des Hauses (1991) zusätzlich benötigten Bedarf an Probenraum und Büros in seinen oberen vier Geschossen.
Die Beispiele sprechen für sich:
Wie Lyon seine Halbinsel, Bruxelles seine Altstadt und Genua seinen Hafen, hat Frankfurt seine Skyline, und diese umstellt in unmittelbarer Nachbarschaft die Städtischen Bühnen am Willy-Brandt-Platz. Die Doppelanlage „ziert“ ein bescheidener Ausdruck im klassischen Stil der sechziger Jahre, und sie duckt sich weg im Windschatten der Hochhäuser. Das Haus und die Bühnentürme, so bemüht und unterschiedlich gestaltet sie auch sind, werden vom Main und seinem Erlebnisraum aus kaum wahrgenommen.
Wie wäre es, den Baukörper mit Luft nach oben – einige Stockwerke höher – neu zu konzipieren, die Bühnentürme im Zusammenspiel mit den Hochhäusern in die Höhe wachsen zu lassen, um fehlenden Raum in allen Sparten und Büro- und Wohnraum für Gäste unterzubringen, begehbare Dächer für Besucher und Aufgänge an den Seitenfronten (siehe Centre Pompidou) zu entwickeln?
Lässt sich die alte Westfassade des ehemaligen Schauspiels in Teilen freistellen, und Grünraum der eingeschnürten Gallusanlage zurückgeben?
Lässt sich die Anlieferung über die Hofstraße verbessern und lassen sich insbesondere die Werkstätten aufstocken und transparent sichtbar machen?
Stichwort „Gläserne Fabrik“.
Kann die Rückseite, die dem so wunderbar gelungenen Jüdischen Museum „das Hinten“ deutlich zeigt, mit Leben gefüllt und als Südseite verstanden werden? Die Ostseite attraktiver werden?
Und dann: die Eingangsfront und das Foyer? Hier wird der Vorraum des freigestellten Bauwerks, der Willy-Brandt-Platz und die Gesamtgestaltung von Platz und Baukörper, angesprochen. Dies (und eine mögliche Änderung des städtebaulichen Umfeldes, etwa die Hofstraße) sollte zum Inhalt der Ausschreibung gehören.
Das Wolkenfoyer möchte ich als Beispiel dafür nennen, dass in einer Ausschreibung eines internationalen Ideenwettbewerbs weitgehende Freiheit im Umgang mit historischen und schützenswerten Bausubstanzen herrschen sollte. Die Entscheidung, diese zu sichern und als Elemente eines Weiterbaus wieder auf- und einzubauen, sollte den Wettbewerbsteilnehmern nicht genommen werden. Ebenso wenig die Freiheit, graue Energie (die durch Abriss vernichtet wird) und goldene Energie (die menschlichen Emotionen, die mit einem lange schon benutzten und „angeeigneten“ Gebäude entstanden sind) so umfassend es geht zu erhalten. In Ideen-Wettbewerben, die mit dieser Freiheit ausgestattet sind, gelingen große Entwürfe eher. Und davon einige, die viele verschiedene Chancen der Entwicklung des Theaters aufzeigen, wären der Stadt Frankfurt zu wünschen. So ist die Luft nach oben als Freiheit zu verstehen.
Das Wichtigste zum Schluss:
Neben allen baurechtlichen, ökologischen, städtebaulichen und künstlerischen Fragen, die sich zur eingangs erwähnten „Spiegellösung“ kritisch stellen lassen, bringt sie doch eine gute Erkenntnis: Die Doppelanlage ist baulich trennbar!
Die bestehende Oper würde für die Zeit ihres Neubaus, östlich nebenan, als gebaute Interimsstätte für den Spielbetrieb gebraucht und dafür autonom ertüchtigt. Diese Machbarkeit wurde bislang von fast allen Seiten bestritten, obwohl der Wiederaufbau nach dem Brand der Oper das Gegenteil belegte.
Und das ist die gute Nachricht: Der Verbleib der Städtischen Bühnen am Ort ist mit dem Willen zu Interimslösungen und einem Weiterbau/Neubau möglich.
Wäre schön, sich an diesem genialen Ort zu treffen!
In Vorbereitung dieses Beitrages bin ich in meinem Archivmaterial auf das nachfolgende Gedicht gestoßen. Damals schrieb ich einen Artikel (FR 05.05.88) über die im November 1987 abgebrannte Oper und Chancen eines klugen Wiederaufbaus. So fiel mir auch die eindrucksvolle „Festschrift der Städtischen Bühnen Frankfurt am Main zur Eröffnung des Großen Hauses im Dezember 1951“ in die Hände. Inzwischen ist der SPD-Kandidat, der im vorstehenden Text erwähnt ist, zum Oberbürgermeister gewählt worden. Ihm möchte ich „die echte Sehnsucht“ (s.u.) wünschen, weil er im Wahlkampf erklärt hat, die Entwicklung der Städtischen Bühnen zur Chefsache machen zu wollen.
Es gibt
kein Vergangenes
das man zurücksehnen dürfte,
es gibt nur ein ewig Neues,
das sich aus den erweiterten Elementen
des Vergangenen zusammensetzt;
und die echte Sehnsucht
muss stets produktiv sein.
J. W. v. Goethe
Zum Autor: Prof. em. Peter G. Lieser, Umweltgestaltung, Kunsthochschule an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Ausbildung in Städtebau TU Darmstadt, Stadtsoziologie J.W.Goethe-Universität Frankfurt, Urban Planning UC Berkeley. Leitung GrünGürtel-Projektbüro Frankfurt und Geschäftsführung GrünGürtel GmbH Frankfurt. Mitarbeiten zur Industriekultur Rhein-Main. Freiberufliche Beratung, Strategieplanung und Journalistische Tätigkeiten.
Sein oder Nichtsein? Theaterbauten in der Sanierung
Die Generalsanierung, gelegentlich auch die umfassende Modernisierung und Erweiterung denkmalgeschützter Theaterbauten und Opernhäuser zählt in Europa zu den großen Konservierungs- und Architekturaufgaben der Gegenwart. Viele Häuser und ihre Ensembles blicken auf eine lange Tradition zurück. Oft verdanken sie ihr ausgezeichnetes internationales Renommee dem hervorragenden künstlerischen Ruf ihrer Ensembles und Programme, nicht selten verbunden und verstärkt durch großartige Bauwerke, die den darstellenden Künsten als Aufführungsorte und dem Publikum als Zuschauerräume dienen. Im September 2021 führte das Deutsche Nationalkomitee von ICOMOS und das Deutsche Architekturmuseum (DAM) Frankfutt zum Thema eine internationale Tagung durch, deren Ergebnisse im April 2023 als Publikation im Hendrik Bäßler Verlag, Berlin erschienen sind. Der Band enthält u.a. einen Aufsatz des Frankfurter Denkmalpflegeres Marco Popp zu den Städtischen Bühnen Frankfurt, eine Text von der Architektin Annette Menting zum Thema „Wer weiß, wie man ein zeitgeössisches Theater oder ein Theater für morgen baut? Vom Auszug aus den Theaterhäusern an brachliegende Orte“ sowie einen weiteren von der Intendantin von Kampnagel, Amelie Deuflhard zu „Be/coming City. Performing Arts als Formate der Raumerkundung“
Architektur und Raum für die Aufführungskünste
Das Forschungsprojekt „Architektur und Raum für die Aufführungskünste“ beschäftigt sich unter der Leitung von Prof. Dr. Barbara Büscher (Hochschule für Musik und Theater Leipzig) und Prof. Dr. Annette Menting (Hochschule für Wirtschaft, Technik und Kultur Leipzig) seit 2017 mit spartenübergreifenden Aufführungsarchitekturen. Das ARBEITSHEFT #4 präsentiert Material und Analysen aus der Fallstudie zu HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste. Neben aktuellen künstlerischen Raum-Praktiken, die die Möglichkeiten des Festspielhauses als Monospace in besonderer Weise bespielen, steht die Geschichte der Wieder-Aneignung des Hauses als Kunstort in den 1990er Jahren im Fokus. Vergleichbare Fallstudien sind bisher zu den Produktionshäusern PACT Zollverein Essen und Forum Freies Theater Hamburg erschienen.

Aus Arbeitsheft #2 PACT Zollverein Essen
Wir verfolgen in diesen wie weiteren Veröffentlichungen Fragen nach dem Zusammenhang zwischen Ort, Gebäude/Raumanordnung und zeitgenössischen Spielformen. So haben wir uns mit Interim-Spielstätten, deren besonderen Raumkonzeptionen und Nutzung beschäftigt oder zu temporären Spielstätten und entsprechenden Szenografien publiziert. Architektur und urbane Verortung von Spielstätten interessieren uns in Hinblick auf die durch sie unterstützten oder (beschränkten) szenischen Praktiken und in Hinblick auf die Öffnung für diverse Akteur:innen, die auch Zuschauer:innen sein können.
Die Diskussion um zukünftige Orte und Architekturen für die Aufführungskünste – durchaus über die Kunstgrenzen von Theater, Tanz, Musik, Performance hinweg verstanden – wird die Erfahrungen und Perspektiven der außerhalb der Stadttheater produzierenden Akteur:innen einbeziehen müssen. Und sie wird danach Ausschau halten müssen, wie der Zugang zu Kunst und Kultur neu eröffnet werden kann. Auf diesen Überlegungen basiert die Konzeption des Forschungsprojektes, das in seiner aktuell zweiten Phase sich auch mit Entwicklungen an der so genannten Peripherie und im ländlichen Raum auseinandersetzt. (Kulturelle) Infra-Strukturen sind ein Thema, das aktuell sowohl in wissenschaftlichen wie künstlerischen Projekten eine wichtige Rolle spielt. Dabei rücken Fragen nach Repräsentation und urbaner Selbstdarstellung mehr und mehr in den Hintergrund und solche der Zugänglichkeit für diverse Nutzer:innen-Gruppen werden wichtig.
Die gesamte Reihe der ARBEITSHEFTE finden Sie als open access Online-Publikation hier: www.perfomap.de/arbeitshefte
Texte zum Thema „Bewegliche Architekturen“, die als Ergebnis einer Konferenz es Forschungsprojektes entstanden sind, sind in der Ausgabe #10 der Online-Magazins MAP (2019) veröffentlicht: www.perfomap.de/map10.
Texte zum Theater-Interim und zu temporären performativen Bespielungen sind in MAP #11 (2021) veröffentlicht: http://www.perfomap.de/map11/temporaere-orte
In Kürze erscheint als MAP#13 eine Ausgabe mit Ergebnissen der Konferenz zu „Urbane Praxis und kulturelle Infrastrukturen“, die im Juni 2022 stattgefunden hat.
Weitere Informationen zum Forschungsprojekt „Architektur und Raum für die Aufführungskünste“ finden Sie unter: http://auffuehrungarchitekturraum.net/title/ und unter https://theaterraum.htwk-leipzig.de/theaterraum
Bestand ist Zukunft!
Um die Gebäude unserer Stadt zu bauen, wurden Unmengen von Energie und Ressourcen aufgewendet – etwa um Stahl und Beton zu produzieren. Jedes Gebäude, das wir abbrechen, muss aufwendig entsorgt werden. Aktuell gehen 55% des gesamten Müllaufkommens in Deutschland auf die Bauwirtschaft zurück. Zudem benötigt jeder Ersatzneubau erneut erhebliche Mengen an Ressourcen, die mit einem bewussten Weiterbauen und Weiternutzen eingespart werden können.
Die aktuellen Diskussionen und Bemühungen zu einer ökologischen Bauwende zur CO2 Einsparung in der Stadt Frankfurt begrüßt der BDA Frankfurt vor diesem Hintergrund ausdrücklich. So reflektiert die lokale Presse aktuell Überlegungen zum Erhalt des Juridicums durch Planungsdezernent Mike Josef und Ideen zu einem Recycling-Pilotprojekt für Abbruchmaterialien am Fiat-Areal von Baudezernentin Sylvia Weber. Kulturdezernentin Ina Hartwig erklärt das Ziel, die Städtischen Bühnen als „ökologisches Leuchtturmprojekt“ zu realisieren.
Die genannten Äußerungen bestätigen einen grundsätzlichen Haltungswandel in der Stadtpolitik. Der Stadtverordnetenbeschluss zum Abbruch und Neubau der Städtischen Bühnen wurde im Jahr 2020 noch auf der Basis einer Bewertungsmatrix gefällt, in der ökologische Kriterien mit fünf Prozentpunkten kaum zum Tragen kamen. Sollen die Städtischen Bühnen nun als „ökologisches Leuchtturmprojekt“ entwickelt werden, so muss konsequenterweise jedoch der Erhalt wesentlicher Bestandsbauteile in situ erneut geprüft werden. Durch einen Komplett-Abbruch und Neubau würden Ressourcen in einem Umfang verbraucht, die mit nach aktuellem technischem Standard betriebenen Neubauten über Generationen nicht wieder eingespart werden können. Hier besteht ein Widerspruch in den Aussagen des Kulturdezernates, wenn es „ökologisch“ bauen mit „neu“ bauen zu verbinden versucht.
Grundsätzlich kann der verantwortungsbewusste Umgang mit den Bauten unserer Stadt nur gelingen, wenn die Möglichkeiten der Bausubstanz und die an sie gestellten Anforderungen zusammenpassen. Mit vielen aktuellen Anforderungen, z. B. an die technische Gebäudeausstattung, den Wärme-, Schall- und Brandschutz, unpassenden funktionalen Vorgaben oder mit übersteigerten Verwertungsinteressen, lässt sich für jedes Gebäude ein Abbruch als (nutzungs-)technisch oder wirtschaftlich rechtfertigend begründen.
Dies zeigt das Beispiel der Dondorf’schen Druckerei in Bockenheim, die am Ende trotz einer 150 Jahre währenden Nutzungstauglichkeit und ihres baukulturellen Werts nun dem Abbruch geweiht zu sein scheint. Ob das Juridicum dem erheblichen Nutzungsdruck der vorliegenden Planungen zum Kulturcampus standhalten wird, bleibt abzuwarten.
Bei der Bundesbank-Zentrale geben die kommunizierten Nachhaltigkeitsziele Anlass zur Hoffnung, dass ein wertschätzender Umgang mit dem denkmalgeschützten Bau und seiner markanten Fassade gelingt und seine ökologischen und baukulturellen Ressourcen weiter genutzt werden.
Sollen die mittlerweile bundesweit politisch geforderte Bauwende und der Bestandserhalt als Beitrag zur klimagerechten Stadt gelingen, so müssen die Anforderungen dem jeweiligen Gebäude entsprechend angemessen entwickelt werden. Zielkonflikte sind ganzheitlich abzuwägen und zu lösen. Für ein solches Vorgehen sind geeignete politische und gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen.
Der BDA appelliert an Eigentümer*innen und Investor*innen sowie an die beteiligten Akteur*innen aus Planung, Stadtverwaltung und Politik, sich den Herausforderungen zu stellen und die konkreten Veränderungen in Richtung der ökologischen Bauwende weiter voranzutreiben: Der Bestand ist die Zukunft!
Im Namen des Vorstandes des BDA Frankfurt
Moritz Kölling (Vorsitzender) und Antje Voigt
Verzerrte Darstellung, viel Überflüssiges und einige blinde Flecken: Die Zukunft der Bühnen Frankfurt in einer Sackgasse
Eine kritische Analyse des neuen Berichts der Stabsstelle „Zukunft der Städtischen Bühnen“ Frankfurt am Main
Mit dem vor zwei Wochen vorgestellten dritten Bericht der Stabsstelle „Zukunft der Städtischen Bühnen“ begründet die Kulturdezernentin der Stadt Frankfurt Main Ina Hartwig ihr Festhalten am Totalabriss der teilweise denkmalgeschützten Theaterdoppelanlage und den Vorschlag, den Neubau für das Schauspiel in den Grünzug der ebenfalls denkmalgeschützten Wallanlage hineinzubauen. Die im Folgenden dargelegte kritische Analyse des Berichts und ein Abgleich mit früheren Aussagen der Stabsstelle zeigt, dass dies nur mit einer gezielten Verzerrung der Sachlage, argumentativen Inkonsistenzen und willkürlichen Bewertungsmethoden möglich ist. In wichtigen Punkten widerspricht der neue Bericht früheren Berichten. Durch die Kampagne für die nunmehr aufgegebene Kulturmeile wurden drei Jahre Zeit verloren, während derer ein dringend benötigtes Produktionszentrum hätte entstehen können, ein essentieller Schritt zur Verbesserung der Arbeits- und Produktionsverhältnisse der Bühnen. Es bedarf eines anderen Umgangs mit der Zukunft der Frankfurter Bühnen, einen handlungsorientierten Pragmatismus, der die Anforderungen von Ökologie, Denkmalschutz und Wirtschaftlichkeit ernst nimmt und auf einer zeitgenössischen, zukunftsorientierten Theaterkonzeption aufbaut.
Und hier nun die kritische Analyse des neuen Berichts der Stabsstelle:
Am 23.2.2023 hat die Stabsstelle „Zukunft der Städtischen Bühnen“ des Kulturdezernats der Stadt Frankfurt ihren dritten Bericht veröffentlicht. Mit ihrem ersten Bericht von Januar 2020 hatte sie den Weg für die wenige Tage später erfolgte Abrissentscheidung der Stadtverordnetenversammlung bereitet. Mit dem zweiten Bericht von September 2021 plädierte die Kulturdezernentin und die ihr unterstellte Stabsstelle für die Variante 2 „Kulturmeile“. Der nun vorgelegte 70-seitige Bericht mit dem Titel „Ergänzende Prüfaufträge zur Zukunft der Städtischen Bühnen, Februar 2023“ favorisiert die „Spiegelvariante“ (Variante 1), bei der das Schauspiel schräg gegenüber dem heutigen Bau in der Wallanlage und die Oper am Standort des heutigen Schauspiels erbaut werden soll. Die zuvor so vehement propagierte Variante Kulturmeile wird nicht mehr angestrebt. Der Bericht stellt nunmehr fest: Es „bietet sich die Realisierung von Oper und Schauspiel auf stadteigenem Grund und Boden an. Dies ist auch ökonomisch nachhaltig“ (S. 59). Dies war schon immer klar. Die zeitweilige Propagierung der Sackgasse Kulturmeile war nur möglich gewesen, weil der zweite Bericht der Stabsstelle die erheblichen Kosten für den erhofften Erwerb des Grundstücks und die damit verbundenen Risiken in der vergleichenden Betrachtung ausgeblendet hatte. Im Fazit hat die von Beginn an äußerst fragwürdige Kampagne für die Kulturmeile den Entscheidungsprozess um drei Jahre verzögert und Steuergelder mindestens im höheren sechsstelligen Bereich gekostet.
Doch nicht nur die gegen die damalige Kritik verteidigten Schlussfolgerungen des zweiten Berichts erweisen sich mit dem dritten Bericht als obsolet. Stillschweigend werden nun auch wesentliche Kriterien des ersten Berichts verändert, welcher damals den Abrissbeschluss begründete. Die Themen Denkmalschutz und das Thema Graue Energie werden nun endlich behandelt und der Risikozuschlag für den Neubau von 10 auf 15 % erhöht, wie schon 2020 von den Kritikern gefordert (http://zukunft-buehnen-frankfurt.de/2020/08/24/validierungsgutachten-widerspricht-der-abrissbegruendung/ veröffentlicht am 24.8.2020). Damit werden der damaligen Abrissentscheidung zentrale Argumente entzogen. Der neue Bericht hinterfragt aber weder die damalige Entscheidung noch zieht er die Möglichkeit eines mit Neubau kombinierten Teilerhalts am jetzigen Standort in Betracht, obwohl dies in Hinsicht auf Ökologie, Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Denkmalschutz die naheliegendste Lösung wäre.

Stattdessen propagiert er nun die Spiegelvariante mit Argumenten, die sich bei genauer Betrachtung als haltlos erweisen. Die mit ihren umfangreichen Detailinformationen sachlich erscheinende Darstellung ist erneut tendenziös, färbt die präferierte Variante schön und stellt die verbliebene alternative Option der Doppelanlage am jetzigen Standort gezielt schlecht dar. Das zeigt sich schon an der unplausiblen Behauptung, dass die Spiegelvariante mit ihrem deutlich größeren Raumprogramm am Standort (da keine Auslagerungen in ein externes Produktionszentrum und keine Synergie einer Doppelanlage realisiert werden) zu 1.200 qm mehr Grünfläche führen soll (S. 25f.).
Bemerkenswert ist, mit welcher Nonchalance der schwerwiegende Eingriff in die geschützte Wallanlage behandelt wird, die in dem Bericht quasi als Baulandreserve für Bauten im öffentlichen Interesse dargestellt wird (S. 48). Dabei schützen die 1827 erlassene „Wallservitut“ und das 1903 eigens hierfür erlassene Gesetz die Wallanlagen trotz des enormen Entwicklungsdrucks weitestgehend vor baulichen Eingriffen, was für die Stadtentwicklung Frankfurts eine „herausragende Rolle“ spielt (siehe Denkmalbegründung Wallanlagen). Die mit der Spiegelvariante vorgesehene Bebauung würde die Wallanlage unterbrechen und ihr südwestliches Ende abtrennen, so dass sie in Zukunft am Willy-Brandt-Platz nicht mehr erfahrbar wäre. Zentrale Sichtachsen und die Lesbarkeit der Stadtstruktur würden hiermit zerstört, was dem Denkmalschutz des Anlagenrings fundamental widerspricht. Es ist auch städtebaulich exakt das Gegenteil dessen, was noch vor einem Jahr mit dem Konzept der Kulturmeile versprochen wurde: Statt einer Stärkung der Wallanlage wird nun deren Beschädigung das Wort geredet, welche mit zahlreichen Euphemismen kaschiert wird. So heißt es, die Spiegelvariante „interpretiert das Gartendenkmal neu“ (S. 37), mit dem „Potenzial, neue öffentliche Stadträume zu erzeugen“ (S. 42) und der Chance für die „Schaffung neuer, qualitativ attraktiver Aufenthaltsbereiche“ (S. 43), was die „Teilhabe schwächerer gesellschaftlicher Gruppen am städtischen Leben gleichberechtigt“ ermögliche (S. 42). All diese mit dem Eingriff in die Wallanlage angeblich erzielbaren Entwicklungschancen – zu denen auch die Unterbringung der unvermeidlichen, aber nicht erwähnten LKW-Anlieferung gehört – seien mit einem Neubau einer Doppelanlage nicht gegeben, bei der alles beim Alten bleiben müsste.

Ganz abgesehen von diesen Schönfärbereien sollte sich in Zeiten Klimakrise ein solcher Eingriff in eine intakte innerstädtische Grünanlage mit der Fällung von einer Anzahl großer, zum Teil hundert Jahre alter und besonders geschützter Bäume ohnehin von selbst verbieten. Es ist offenkundiges Greenwashing, dass der Bericht diesen Malus mit vermeintlichen Pluspunkten gegenüber der Doppelanlage zu kompensieren behauptet, mittels fadenscheiniger Konstrukte wie „Baumneupflanzungspotenziale“, „Pflegezustand und Artenvielfalt der Pflanzflächen“, „Gestaltungspotenziale für neue biologische Vielfalt“, „Abflussminderung Regenwasser“, „Steigerung Naherholungspotenzial“, Potenzial „Sitzgelegenheiten und Wege“ (S. 50, 51). Ebenso unglaubwürdig ist, dass als Interim der Spiegellösung der Schauspielneubau als Operninterim genutzt und damit Kosten von 50 Mio. € eingespart werden könnten (S. 32), womit die eigentlich teuerste Variante als die billigste Lösung erscheinen soll.
Nur wenige Sätze sind der Frage gewidmet, dass für die Spiegellösung die Aufstellung eines neuen Bebauungsplans erforderlich ist (S. 48). Doch dies ist keine Petitesse. Erste Reaktionen lassen erkennen, dass mit erheblichem Widerstand aus der Stadtgesellschaft gegen den propagierten Eingriff in die Wallanlage zu rechnen ist. Ein Bebauungsplanverfahren erfordert eine Bürgerbeteiligung und eröffnet Klagemöglichkeiten, von denen anzunehmen ist, dass diese von Vertretern des Natur-, Klima- und Denkmalschutzes wahrgenommen werden.
Surreal sind die Ausführungen zur Grauen Energie, weil zuvor jeglicher Bestandserhalt ausgeschlossen wird, um dann tautologisch für alle Neubaulösungen die gleiche ökologische Wertigkeit festzustellen (S. 23) und diesen ein freundlich grünes Plus (S. 50) zuzugestehen. Doch allein die Variante Doppelanlage erlaubt die Weiternutzung von Bestandsbauteilen, sei es des denkmalgeschützten Foyers oder des erst 2014 für 80 Mio. € fertiggestellten Werkstattanbaus. Die Möglichkeit der Weiternutzung des letzteren wurde gar nicht geprüft, und die Sinnhaftigkeit des Foyererhalts in Abrede gestellt, im Fazit dann beide Möglichkeiten gleichermaßen verworfen bzw. ignoriert.
Beim Foyer sei eine Betonsanierung erforderlich, die zur Folge habe, dass etwa 90% der historischen Bausubstanz verloren gehe (S. 33, 38, 54f.). Dies – so wird suggeriert – komme dem Verlust des Denkmals quasi gleich. D.h. egal für welche Variante man sich entscheide, das Denkmal sei in jedem Falle verloren. Doch Denkmalschutz reduziert sich nicht auf die Frage der Materialität. Selbst bei Denkmalen wie den Welterbestätten Hildesheimer Dom oder dem Bauhausgebäude Dessau ist dies nur in sehr begrenzter Weise der Fall, während Raum, Konzeption und Nutzung ein großes Gewicht haben. Geschützt ist nicht allein die materielle Bausubstanz, deren Erneuerung sanierungsbedingt unvermeidbar sein kann, sondern die Gesamterscheinung, deren Verlust vermeidbar ist. Risiken und Aufwand könnten hierbei begrenzt werden, wenn auf die von der Stabsstelle eingeforderte Unterkellerung des denkmalgeschützten Foyers (S. 54) verzichtet und auch erwogen würde, die anschließende Zuschauerbereich zu erhalten, was auch im Sinne des Denkmalschutzes wäre.
Der Bericht legt es mit einer Vielzahl von Formulierungen darauf an, das Denkmal schlecht und klein zu reden. Das Kunstwerk von Zoltan Kemeny wird flapsig „Blechwolken“ genannt (S. 57), das lediglich „unter Aufsicht des Künstlers gefertigt und aufgehängt“ worden sei (S.40), so als stamme es nicht von Kemeny selbst. Es wird nicht als das, was es ist – eine ortsspezifische Raumskulptur – wertgeschätzt, sondern wie ein serieller dekorativer Innenraumschmuck beschrieben, der „auch überall anders neu aufgehängt werden“ (S. 40) und nach Belieben in anderen Bauten und Räumen zum Einsatz kommen könne.
Die Aversion gegen die Variante einer Doppelanlage am Standort geht so weit, dass die erforderlich planerische Prüfung und Vorbereitung dieser Option trotz des von Magistrat und Stadtverordnetenversammlung ausgesprochenen Prüfauftrages vernachlässigt worden ist. Dieses eigene Versäumnis wird jetzt als Argument gegen diese Option selbst zu Felde geführt.
In den Untersuchungen von 2018/2019 war aufgrund der beengten Verhältnisse im Stadtzentrum die sinnvolle Idee eines Produktionszentrums entwickelt und ein eigener Bericht hierzu vorgelegt worden. In diesem verkündete die Stabsstelle damals: „Für die Städtischen Bühnen Frankfurt sowie für die Stadt Frankfurt am Main hat das Produktionszentrum zahlreiche Vorteile und es ermöglicht einen synergiereichen, optimierten, zukunftsfähigen, ressourcenschonenden und nachhaltigen Betrieb der Werkstatt- und Lagerfunktionen. (…) Die Ergebnisse der Untersuchung zur Sanierung zeigen klar, dass ein Produktionszentrum in einer überschaubaren Zeit realisierbar ist.“ Falls erforderlich, „können die Probebühnen auch im Produktionszentrum untergebracht werden“, auch wenn eine Zuordnung zu den Hauptspielstätten für die internen Betriebsabläufe zu bevorzugen sei. (Bericht zum Produktionszentrum, Stand 25.2.2020, S. 8,9). Ein solches Produktionszentrum ist auch vielerorts üblich (z.B. Staatstheater Hannover; Staatsoper Hamburg; Royal Opera House Thurrock, London; Glyndebourne Opera House, East Sussex; The Karayanis Rehearsal Production Center, Dallas Opera; Utah Opera Production Building, Salt Lake City). Doch nun soll das, was 2020 festgestellt wurde, nicht mehr stimmen, sondern genau dessen Gegenteil. Mit dem Zweiten Bericht von Herbst 2021 wurde das zuvor aufwändig entwickelte Konzept sang- und klanglos beerdigt (dort S. 42/ 43) und nicht mehr weiterverfolgt. Nun wird die Nichtbearbeitung dieser Frage der Variante „Doppelanlage“ als Malus zugerechnet, weil vor deren Bau überhaupt erst eine Standortsuche erfolgen müsse (S. 33). Dies ist umso bitterer, da dies, wie auch die ebenfalls erforderliche, aber unterbliebene Klärung von Interimsspielstätten, zeitlich zu allererst erfolgen müsste. Es hilft nichts, trotz des dreijährigen Stillstands ist die umgehende Realisierung eines Produktionszentrums geboten und auch die einzige mögliche Maßnahme, um die Arbeitsbedingungen für eine Vielzahl der Mitarbeiter*innen der städtischen Bühnen zeitnah grundlegend zu verbessern und die Fortsetzung des Spielbetriebs zu sichern. Sie bietet auch den Vorteil, an einem zweiten, nicht so zentralen Standort mit Werkstattarbeit und ggf. Probebühnen einen kulturellen Impuls zu setzen und sich so in anderer Weise der Stadtgesellschaft zu öffnen, was auch Potenzial für Kooperationen und Synergien mit anderen kulturellen Aktivtäten bietet.
Unbegreiflich ist, dass auch die Interimsfrage offenkundig nicht gelöst ist. Keines der Szenarien kommt ohne Interim aus, und es zeichnet sich dabei ab, dass ein Operninterim unvermeidbar ist, weil die neuen Standorte allenfalls für einen Schauspielneubau geeignet sind. Doch wo die erforderliche(n) Interimsspielstätte(n) wie realisiert werden können und sollen, dazu schweigt der Bericht.
Das Vorgehen ist bizarr: Mit großer Akribie widmet sich die unterstellte Stabsstelle des Kulturdezernats (und nicht etwa des Amtes für Bau und Immobilien) den baulichen Details von „über 60 neuen Bewertungskriterien“ (S. 10), von denen zahlreiche gar nicht entscheidungsrelevant sind, wie der Bericht auch immer wieder einräumt. Während hier vieles längst überuntersucht und von geringem Erkenntnisgewinn ist, ist anderes Entscheidungsrelevantes unterbelichtet bzw. gar nicht betrachtet. Dies gilt nicht nur für die Fragen Interim und Produktionszentrum, sondern vor allem für Fragen der kulturellen Konzeption. Weder gibt es eine ernsthafte Befassung mit der Zukunft des Stadttheaters noch wurde etwa der Frage nachgegangen, ob Synergien gefunden werden können mit den parallelen Planungen für den Neubau der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (HfMdK) in Verbindung mit einem Zentrum der Künste, gewünschten Produktionsorten der freien Szene oder dem English Theatre. Hier wäre das Kulturamt in seiner Kernkompetenz gefragt, aber schweigt sich aus. Auch dies muss nun unverzüglich nachgeholt werden.
Aus der kritischen Lektüre der drei Berichte der Stabsstelle ergibt sich eine klare Handlungsperspektive: Parallel zum Bau des Produktionszentrums sollte die Stadt zeitnah für die Doppelanlage am Willy-Brandt-Platz einen ergebnisoffenen Architekturwettbewerb ausloben, der es den Teilnehmer*innen überlässt, gemäß der von ihnen entwickelten Konzeption zu entscheiden, welche Teile des Bestands sie abreißen und durch Neubau ersetzen und welche Teile sie sanieren und um- und weiterbauen wollen.
Maren Harnack, Philipp Oswalt, Alfons Maria Arns, Hanns-Christoph Koch
Initiative Zukunft Bühnen Frankfurt
Downloads:
Abbruch statt Aufbruch? Der Bericht zur Zukunft der Städtischen Bühnen Frankfurt von Februar 2023
Mehr Grün trotz mehr Baufläche? Sechs Jahre Oper im zu kleinen Schauspiel? Mehr Fragen als Antworten!
Die Initiative Zukunft Bühnen Frankfurt begrüßt die Entscheidung, die städtischen Bühnen am einzig plausiblen Standort Willy-Brandt-Platz zu belassen. Allerdings gibt der jetzt vorgelegte Abschlussbericht vom Februar 2023 Anlass zu großer Sorge, denn die vom Kulturdezernat präferierte Spiegellösung ist keine – sie wurde bereits vor Jahren erwogen und aus guten Gründen verworfen. Die neue Studie zu den städtischen Bühnen zeigt: Anstatt an einer tragfähigen und zeitgemäßen Lösung zu arbeiten, wurde durch die Kulturmeile wertvolle Zeit vertan. Sie hätte genutzt werden müssen, um die Arbeitsbedingungen der Angestellten unserer Städtischen Bühnen schnell zu verbessern.
Die Initiative Zukunft Bühnen Frankfurt warnt: Die Verantwortlichen verlaufen sich in den Verästelungen des Projekts, geben Studien zu Details in Auftrag und ignorieren deren grundlegende blinde Flecken. Ein markantes Beispiel: Auch die jetzt vorgelegte Studie gibt die Ergebnisse des Validierungsgutachtens von 2020 falsch wieder und kommt zu Schlüssen, die denen der am Validierungsgutachten beteiligten Expert:innen eindeutig widersprechen.
Die Spiegellösung verweigert sich geradezu kategorisch den brennenden Themen unserer Zeit, etwa dem ecological turn in Architektur- und Theaterwelt oder der Repräsentationskrise sich diversifizierender Stadtgesellschaften. Sie ignoriert alle Erfahrungen, die in den letzten Jahren bei der Entwicklung neuer Stadttheatermodelle gemacht wurden. Anstatt sich einer Altes und Neues verbindenden Weiterentwicklung des Bestandes zu stellen, wird eine im schlechtesten Sinne modernistische, aus der Zeit gefallene Maximallösung verfolgt und ein identifikationsstiftendes Kulturdenkmal zerstört. Die Initiative Zukunft Bühnen Frankfurt denkt: Die öffentliche Hand muss glaubwürdig vorleben, was demnächst von der Privatwirtschaft erwartet wird!
Die Pläne für die beiden neuen Häuser am Willy-Brandt-Platz für die städtischen Bühnen laufen abgekoppelt von den Planungen für das Zentrum der Künste und den mit ihm eng verknüpften Neubau der HfMDK. Die Initiative Zukunft Bühnen Frankfurt stellt fest: 1+1+1+1= Null. Die einzelnen städtischen Bauprogramme schreiben die Bedarfe der Gegenwart fort und sind damit das Gegenteil von zukunftsfähig. Sie dürften bereits bei ihrer Eröffnung in den 2030er-Jahren hoffnungslos veraltet sein. Anstatt der vermeintlich alternativlosen Weiterführung des Neubauprojekts fordern wir eine von Stadt und Land gemeinsam getragene, ergebnisoffene Studie zur Theaterentwicklung der Stadt, die zunächst fragt, was der Stadt und ihren Theatergänger:innen, den vielen Besucher:innen aus Region und Land und vor allem auch den (Noch-)Nicht-Theaterbesucher:innen wertvoll ist und was daraus entstehen kann. Bei einem Wettbewerb für die Städtischen Bühnen sollte die Ausschreibung so offen formuliert sein, dass unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes ein Weiterbauen ebenso möglich ist wie eine Neubaulösung.
Die Initiative Zukunft Bühnen Frankfurt fordert vor allem: mehr Pragmatismus wagen! Um nicht noch mehr Zeit zu verlieren und für den Standort Willy-Brandt-Platz Spielraum zu gewinnen, müssen neue Prioritäten gesetzt werden: An erster Stelle steht der zügige Aufbau eines gemeinsamen Produktionszentrums für die beiden Häuser und für die freie Szene, beispielsweise in Bockenheim. Es kann zunächst als Interim dienen und perspektivisch Oper, Schauspiel und Zentrum der Künste in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander produzieren lassen. Damit würden die seit Jahren inakzeptablen Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden unserer Städtischen Bühnen schnellstmöglich verbessert und eine sukzessive Verschränkung des Produzierens in den Häusern und den Freien Künsten möglich. Wir regen außerdem an, das Land Hessen bei der Finanzierung dieser innovativen Aufgabe in die Pflicht zu nehmen. Es kann dadurch die Stadt entlasten und so die Leistung der Frankfurter Theaterkultur für das gesamte Bundesland auch finanziell anerkennen.
Die Initiative Zukunft Bühnen Frankfurt meint: Theater und Oper sind ein Luxus, den wir uns leisten sollten. Aber: Wenn die Bauvorhaben ohnehin sehr teuer werden, dann brauchen wir im Zentrum dieser Stadt eine zukunftsfähige, innovative Lösung und nicht die bloße Fortschreibung bürgerlicher Repräsentationsformen aus dem vergangenen Jahrhundert!
Alfons Maria Arns, Maren Harnack, Hanns-Christoph Koch, Nikolaus Müller-Schöll, Philipp Oswalt
für die Initiative Zukunft Bühnen Frankfurt, 3. März 2023
Neuerscheinung: Zoltan Kemenys Frankfurter Wolkenfoyer
Entstehung und Zukunft einer gefährdeten Raumkunst
der Initiative Zukunft Bühnen Frankfurt
erschienen im Deutschen Kunstverlag, 28 €
160 Seiten, zahlreiche Abbildungen in schwarz/weiß und Farbe
Die Raumskulptur des Künstlers Zoltan Kemeny im Glasfoyer der Städtischen Bühnen Frankfurt am Main prägt das Gesicht des Hauses. Von weit her sichtbar kontrastiert das über 100 Meter lange Kunstwerk von 1963 in seiner organischen Dynamik und betonten Handwerklichkeit mit der Architektur des Gebäudes.
Aufbauend auf neuen Forschungen stellt das Buch Künstler, Kunstwerk und die Genese und Rezeption des den Frankfurtern ans Herz gewachsenen Werks in Text und Bild vor. Neue studentische Entwürfe zeigen unterschiedliche Optionen auf, wie der Erhalt des vor kurzem unter Denkmalschutz gestellten Werkes mit einer konzeptionellen Revision der Städtischen Bühnen Hand in Hand gehen kann.
Dieses Buchprojekt wurde ermöglicht durch die großzügige Unterstützung von Kuratorium Kulturelles Frankfurt, Kulturamt der Stadt Frankfurt am Main, Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Bund Deutscher Architektinnen und Architekten BDA Frankfurt und zahlreiche Spenden.
Never demolish, always add, transform or reuse
Vortrag von Jean-Philippe Vassal, Lacaton & Vassal Architectes (Paris)
Anlässlich der Debatte um die Zukunft der Bühnen Frankfurt hielt Jean-Philippe Vassal im Mai 2022 einen Vortrag an der Frankfurt University of Applied Sciences. Einerseits gingh er auf die Frage ein, wie Bestandsbauten weitergebaut, baulich und konzeptuell weiterentwickelt und aktualisiert werden können (u.a. anhand aktueller Projekte wie Maaghallen Zürich). Zum adressirter er die Frage des Stadttheater von heute adressieren: Wir können neue Formen von Öffentlichkeit, des Performativen und der Interaktion in Bühnenbauten der Gegenwart realisiert werden (u.a. anhand der Projekte Salle de spectacle polyvalente, Lille)
Foto: Lacaton-Vassal: Salle de spectacle polyvalente, Lille. Foto: Phlippe Ruault