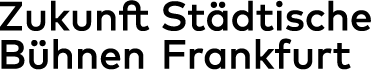Im Gespräch mit FR-Redakteur Claus Jürgen Göpfert legt die Schriftstellerin Katharina Hacker ihr Verständnis von Stadttheater dar und erzählt von ihren Erlebnissen mit den Frankfurter Bühnen als Jugendliche, die in Frankfurt aufgewachsen ist. Hier der link zum Interview:
Pressestimmen
Hier finden Sie chronologisch geordnet Presseveröffentlichungen rund um die Zukunft der Städtischen Bühnen Frankfurt am Main. Sollten Sie einen Beitrag vermissen, schreiben Sie uns. Wir stellen ihn gerne ein: redaktion@zukunft-buehnen-frankfurt.de
Reaktionen zu unserer Stellungnahme „Abbruch statt Aufbruch?“, 1: In einem Artikel zum Stand der Planungen und Debatten zu den Städtischen Bühnen berichtet Rainer Schulze auch ausführlich über die Stellungnahmen der Architects For Future Frankfurt und unserer Initiative zu den Plänen der Stabsstelle; FAZ, 15. Februar 2022 (Paywall)
Reaktionen zu unserer Stellungnahme „Abbruch statt Aufbruch?“, 2: Auch die Frankfurter Rundschau (Oliver Teutsch) berichtet über unsere Stellungnahmen vom 15.2.2022; FR, 15. Februar 2022
Reaktionen zu unserer Stellungnahme „Abbruch statt Aufbruch?“, 3: Das Journal Frankfurt widmet sich in einem Beitrag vom 16. Februar ebenfalls unseren Stellungnahmen und Forderungen
Das Theater für die Stadt Eva-Maria Magel berichtet in der FAZ über die 2. Podiumsdiskussion in der Reihe „Welches Theater für welche Stadt?“ vom 17.2.2021; FAZ, 19. Februar 2021
Ein gelungenes kultursoziologisches Experiment In seinem Kommentar zum Interview mit dem Opernintendanten Bernd Loebe beschreibt Alfons Maria Arns die ursprüngliche Intention und erinnert an die Qualitäten des Neben- und Miteinanders von Oper und Schauspiel in der Doppelanlage; FR, 11. Februar 2021
Mit gutem Beispiel voran! In einem Interview in der FAZ nimmt Maren Harnack auch Stellung zur Debatte um die Zukunft der Städtischen Bühnen und fordert, den Bestand ebenso respektvoll wie kreativ weiterzuentwickeln; FAZ, 3. Februar 2021 (Paywall)
Es geht auch anders Die Architekten Till Schneider und Michael Schumacher äußern sich in einem aufschlussreichen Interview auch zur Machbarkeitsstudie zu den Städtischen Bühnen, an deren Validierung Sie federführend beteiligt waren; FAZ, 25. Januar 2021
Als kaum jemand an der Moderne zweifelte Ausführlicher Kommentar von Michael Hierholzer zum geplanten Erhalt des Wolkenfoyers in der FAZ vom 7. Januar 2021 (Paywall)
Gespräche zur Lage der Stadt Der Architekt Christoph Mäckler begrüßt in einem Interview den geplanten Erhalt des Wolkenfoyers, FAZ, 7. Januar 2021 (Paywall)
Hartwig: „Idee der Kulturmeile wird gestärkt“ Bericht von Ronja Merkel über den Denkmalwert der Bühnen und die Debatte um die „Kulturmeile“ im Journal Frankfurt vom 22. Dezember 2020
Streit um das Bühnen-Gebäude In einem Beitrag in DLF Kultur, der vor allem die Vorkommnisse vor dem DAM am 8.12. zum Thema hat, geht Nikolaus Bernau auch auf die „superelegante“ Architektur des Gebäudes der Städtischen Bühnen ein (18. Dezember 2021)
Denkmalschutz für das Wolkenfoyer Bericht von Julia Lohrenz in der Frankfurter Neue Presse vom 3. Dezember 2020
Wolkenfoyer hat Denkmalwert Bericht von Sina Eichhorn im Journal Frankfurt vom 3. Dezember 2020
Planungsdezernent Mike Josef und Kulturdezernentin Ina Hartwig (beide SPD) halten die Bewahrung des Städtische-Bühnen-Foyers mitsamt seiner gläsernen Fassade sowie der Wolken-Installation von Zoltán Kemény für unbedingt notwendig. Nachricht in der FAZ vom 2. Dezember 2020
„Auch eine Sanierung der Städtischen Bühnen ist möglich“ Nachbericht über unsere Gesprächsreihe „Zur Zukunft der Städtischen Bühnen Frankfurt“, von Rainer Schulze, erschienen in der FAZ vom 25. November 2020
Die große Frage am Willy-Brandt-Platz Bericht von Sina Eichhorn im Journal Frankfurt am 24. November 2020 über die Diskussion Kulturikone weiterbauen?
Denkmalschützer möchten keinen Neubau der Städtischen Bühnen. Doch die große Frage lautet, wie lange sich der Spielbetrieb noch aufrechterhalten lässt, ohne dass die Bauaufsicht einschreitet. Kommentar von Rainer Schulze in der FAZ vom 18. November 2020
Kunsthistoriker: Frankfurter Bühnen-Foyer auf Roter Liste Bericht auf ZEIT online vom 16. November 2020
Städtische Bühnen auf Roter Liste Denkmalpfleger fordern den Erhalt der denkmalgeschützten Teile der Frankfurter Städtischen Bühnen. Bericht im Morgenweb vom 16. November 2020
Frankfurter Bühnen-Foyer auf Rote Liste für Denkmalschutz gesetzt
Bericht auf t-online vom 16. November 2020
Kunsthistoriker: Frankfurter Bühnen-Foyer auf Roter Liste Gutachten hatten ergeben, dass eine Sanierung der Doppelanlage am Willy-Brandt-Platz, in der Oper und Schauspiel untergebracht sind, teuerer – Bericht auf RTL Online vom 16. November 2020
Denkmalschützer fordern den Erhalt der Theater-Doppelanlage am Frankfurter Willy-Brandt-Platz. Sie haben das Gebäude nun auf eine „Rote Liste“. Bericht in der FAZ vom 16. November 2020

Interview mit unseren Initiator_innen Maren Harnack und Nikolaus Müller-Schöll in der Frankfurter Rundschau vom 23. Oktober 2020
„Sanierung der Bühnen ökologischer als Neubau“ Von Rainer Schulze, erschienen in der FAZ vom 25. August 2020
Weitere Wendung: Gutachten zu den Bühnen Frankfurt veröffentlicht Bericht auf nachtkritik.de vom 24. August 2020
Initiative sieht Erhalt der Städtischen Bühnen bestätigt Bericht im Journal Frankfurt vom 25. August 2020
Neubau der Städtischen Bühnen soll durch Initiative verhindert werden Von Georg Leppert, erschienen am 25. August in der Frankfurter Rundschau
Grüne fordern Tanz-Sparte Interview mit Sebastian Popp, kulturpolitischer Sprecher der Grünen, mit Claus-Jürgen Göpfert, erschienen am 4. August in der Frankfurter Rundschau
Die Architektur des Schauspiel- und Opernhauses in Frankfurt signalisiert Transparenz. Weil technisch aber veraltet, soll der Bau weg. Von Shirin Sojitrawalla, erschienen in der taz vom 30. Juni 2020
Frankfurt: Sparkasse dementiert Gespräche über Kulturmeile Von Claus-Jürgen Göpfert. erschienen am 22. Juni 2020 in der Frankfurter Rundschau
Architekturmuseum spielt Varianten für Frankfurter Städtische Bühnen durch Erschienen am 22. Juni in der NMZ Neue Musikzeitung
Kaum Unterschiede beim Preis für neue Frankfurter Bühnen Von Claus-Jürgen Göpfert, erschienen am 23. Juni 2020 in der Frankfurter Rundschau
Vier Varianten, nur eine zählt (PAYWALL) Von Michael Hierholzer in der FAZ vom 20. Juni 2020
Oper Frankfurt in einem Hybrid-Hochhaus Von Florian Leclerc am 19. Juni 2020 in der Frankfurter Rundschau
Kulturmeile im Bankenviertel Von Ludger Fittkau im Deutschlandfunk vom 19. Juni 2020
Bühnen Frankfurt: „Fragezeichen beim Standort Neue Mainzer“ Interview mit Sebastian Popp, Grünen-Fraktionschef von Claus-Jürgen Göpfert und Florian Leclerc in der Frankfurter Rundschau vom 18. Juni 2020
Stadtplaner Christoph Mäckler fordert mehr Grün am Willi-Brandt-Platz Im Gespräch mit Claus-Jürgen Göpfert vom 16. Juni 2020, erschienen in der Frankfurter Rundschau
Es ist still geworden um den Tanz in Frankfurt. Sollte Jacopo Godani mit seiner Dance Company nach drei Monaten der Absenz nicht so vor das Publikum treten, dass dahinter ein überraschendes Konzept erkennbar wird? Von Wiebke Hüster, erschienen am 17. Juni 2020 in der FAZ
„Kulturmeile“ Frankfurt: Dezernentin Hartwig umwirbt die Grünen Von Claus-Jürgen Göpfert und Florian Leclerc in der Frankfurter Rundschau vom 16. Juni 2020
Streit um Städtische Bühnen: Plötzlich singen alle Loblieder auf die Kulturmeile Von Simone Wagenhaus am 15. Juni 2020 in der Frankfurter Rundschau
Zehn Jahre bis zum Theaterviertel (PAYWALL) Von Rainer Schulze, erschienen am 11. Juni 2020 in der FAZ
Mehr Urbanität wagen Ein Kommentar von Michael Hierholzer in der FAZ vom 10. Juni 2020
Die Stadträte Ina Hartwig und Mike Josef planen eine Kulturmeile an den Frankfurter Wallanlagen. Herzstück könnten zwei Neubauten der Städtischen Bühnen werden. Von Matthias Alexander und Michael Hierholzer, erschienen in der FAZ vom 10. Juni 2020
Schauspiel Frankfurt: Traum von einer „Kulturmeile“ Von Claus-Jürgen Göpfert in der Frankfurter Rundschau vom 11. Juni 2020
CDU beharrt auf Städtische Bühnen am Osthafen Von Claus-Jürgen Göpfert. erschienen am 8. Juni 2020 in der Frankfurter Rundschau
Bleiben die Städtischen Bühnen doch? Von Martina Metzner auf Swiss-Architects vom 3. Juni 2020
Kulturdezernentin Ina Hartwig: „Es kann keine Lösung sein, nichts zu tun“
Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig zur Diskussion über das womöglich denkmalwürdige Wolkenfoyer der Theaterdoppelanlage – im Gespräch mit Claus-Jürgen Göpfert in der Frankfurter Rundschau vom 6. Juni 2020
Dreierlei halb Kommentar von Christian Thomas in der Frankfurter Rundschau vom 24. Mai 2020
„Ich gehe davon aus, dass die Summe von 900 Millionen Euro, die für den Neubau der Städtischen Bühnen Frankfurt angesetzt ist, deutlich zu hoch ist“, sagt der Architekt Roland Burgard im Gespräch mit SWR 2, der in den 1970er und 1980er Jahren im Hochbauamt maßgeblich an der Planung des Frankfurter Museumsufers beteiligt war.
Denkmalschutz für CDU kein Argument Von Claus-Jürgen Göpfert. erschienen am 25. Mai 2020 in der Frankfurter Rundschau
Schützenswerte Wolken Kommentar von Michael Hierholzer, erschienen am 23. Mai 2020 in der FAZ
Das Landesdenkmalamt hat entschieden, dass ein Teil von Frankfurts Theater-Doppelanlage unter Denkmalschutz gestellt werden soll. Wartet auf die Städtischen Bühnen doch noch ein gutes Ende? Von Niklas Maak, erschienen am 23. Mai 2020 in der FAZ
Roland Burgard zur Frankfurter Theaterdebatte, im Gespräch mit Claus-Jürgen Göpfert, erschienen am 21. Mai 2020 in der Frankfurter Rundschau
Doch kein Abriss? Von Ronja Merkel, erschienen im Journal Franfurt vom 22. Mai 2020
Teil der Städtischen Bühnen unter Denkmalschutz Von Rainer Schulze, erschienen im Regionalteil der FAZ vom 22. Mai 2020
„Ich würde gerade jetzt in eine Bühnen-Sanierung investieren“
Micha Brumlik plädiert für einen besonnenen und liebevollen Umgang mit der Frankfurter Theaterdoppelanlage – und könnte sich eine repräsentative Umfrage in der Bevölkerung vorstellen, Interview erchienen in der Frankfurter Rundschau am 6. Mai 2020
„Bei Liebesszenen lassen wir uns was einfallen“ Schauspielhaus-Intendant Anselm Weber im Gespräch mit Claus-Jürgen Göpfert über Theater während der Corona-Krise und die Zukunft der Städtischen Bühnen in Frankfurt, erschienen am 7. Mai 2020 in der Frankfurter Rundschau
Öffnet die Visiere Von Christian Holl, erschienen am 4. Mai 2020 auf Marlowes
„Signum und Herzstück dieser Theaterinsel“ Leserbrief von Alfons Maria Arns im Regionalteil der F.A.Z vom 27. April 2020, S. 32
Die Schriftstellerin und Theaterenthusiastin Katharina Hacker plädiert für den Erhalt der vom Abriss bedrohten Frankfurter Theaterdoppelanlage. Interview mit Claus-Jürgen Göpfert, erschienen am 22. April 2020 in der Frankfurter Rundschau
„Städtische Bühnen: Was kommt?„
Von Daniel Bartetzko, erschienen am 19. April 2020 auf Moderne Regional

„Tausende für den Erhalt der Bühnen in Frankfurt“
Von Florian Leclerc, erschienen am 16. April 2020 in der Frankfurter Rundschau
Architekt Jürgen Engel von KSP Jürgen Engel Architekten im Interview mit Claus-Jürgen Göpfert, erschienen am 13. April 2020 in der Frankfurter Rundschau
Der Architekt und Theaterenthusiast Jochem Jourdan nennt Motive und Argumente für die Rettung der historischen Theaterdoppelanlage im Zentrum Frankfurts. Im Interview mit Claus-Jürgen Göpfert, erschienen am 3. April 2020 in der Frankfurter Rundschau
„Gute Geschichte, schlechte Idee“ (PAYWALL)
Von Michael Hierholzer, erschienen am 8. April 2020 in der F.A.Z.
„Corona-Krise in Frankfurt: OB Feldmann bremst Mega-Projekt“
Meldung, erschienen am 1. April 2020 in der Frankfurter Rundschau
„Investition in Städtische Bühnen ‚steht erstmal nicht an’“
dpa Meldung, am 31. März 2020 in der F.A.Z.
„Marode Schulen und eine Milliarde für Hochkultur“
Hörfunk-Beitrag von Ludger Fittkau, erschienen am 26. März 2020 im Deutschlandfunk
„Wolken unter Denkmalschutz?“
Von Martina Metzner, erschienen am 18. März 2020 auf German Architects
Noch hat Frankfurt das Image einer weltoffenen Stadt mit vielfältiger Kultur. Nicht nur die Paulskirche, auch die Rolle als Vorzeigestadt der Moderne ist Teil dieser Identität: In den 1920er Jahren das Neue Frankfurt, eine international gefeierte Modellstadt der sozialen Stadtplanung, nach dem Zweiten Weltkrieg das in der Architektur des Wiederaufbaus manifestierte Bekenntnis zum demokratischen Neuanfang in der Metropole des Wirtschaftswunders. Doch dieses Image ist bereits ausgehöhlt. Von Sandra Pappe, erschienen auf Marlowes, 17. März 2020
„Raab Karcher will am Osthafen in Frankfurt bleiben und nicht den Bühnen weichen“
Von Florian Leclerc, erschienen am 12. März 2020 in der Frankfurter Rundschau
„Bühnen-Initiative geht von ‚Geheimhaltung’ von Berichten aus“
Von Florian Leclerc, erschienen am 12. März 2020 in der Frankfurter Rundschau
„Städtische Bühnen Frankfurt: Petition für den Erhalt des Wolkenfoyers“
In Frankfurt hat eine Initiative um zwei Architekten eine Petition vorgestellt, die unter anderem das Wolkenfoyer am Willy-Brandt-Platz erhalten soll. Sie hat mehr als 400 Erstunterzeichner. Von Florian Leclerc, erschienen am 9. März 2020 in der Frankfurter Rundschau
„Geschichtsvergessen in Frankfurt am Main“
Meldung, erschienen am 9. März auf Baunetz
„Der große Bluff“
Von Christian Thomas, erschienen am 7. März 2020 in der Frankfurter Rundschau
„Städtische Bühnen in Frankfurt sollen unter Denkmalschutz“
Von Claus-Jürgen Göpfert, erschienen am 5. März 2020 in der Frankfurter Rundschau
„Ort für Bühnen: SPD will Osthafen als Industriestandort in Frankfurt erhalten“
Von Florian Leclerc, erschienen am 3. März 2020 in der Frankfurter Rundschau
„CDU-Politikerin wirbt für Bühne im Osthafen“
Von Florian Leclerc, erschienen am 2. März 2020 in der Frankfurter Rundschau
„Entwurf für Städtische Bühnen im Osthafen erntet geteiltes Echo“
Von Florian Leclerc, erschienen am 29. Februar 2020 in der Frankfurter Rundschau
„OMA steht nachdrücklich hinter diesem Design“
Von Ronja Merkel, erschienen am 28. Februar 2020 im Journal Frankfurt
„OMA präsentiert Entwurf für städtische Bühnen“
Von Ronja Merkel, erschienen am 27. Februar 2020 im Journal Frankfurt
„FR-Stadtgespräch: Frankfurter Bühnen: Streit über die Zukunft des Willy-Brandt-Platzes“
Von Georg Leppert, erschienen am 19. Februar 2020 in der Frankfurter Rundschau
„Städtische Bühnen: Standorte sollen im April feststehen“
Von Claus-Jürgen Göpfert und Florian Leclerc, erschienen am 17. Februar 2020 in der Frankfurter Rundschau
Nicht nur das Baurecht, auch geltungssüchtige Intendanten und Politiker sind schuld daran, dass Bühnensanierungen hierzulande so teuer sind. Von Falk Jaeger, erschienen am 16. Februar 2020 im Tagesspiegel
„Oper Frankfurt: „Die Entscheidung hinauszuschieben, ist am Ende die teuerste Variante“
Alexandra Stampler-Brown, Geschäftsführende Direktorin der Deutschen Oper am Rhein, im Interview mit Claus-Jürgen Göpfert, erschienen am 14. Februar 2020 in der Frankfurter Rundschau
Stadtsoziologin Carola Scholz (Grüne) will eine längere Lebenszeit für Frankfurts Städtische Bühnen und mehr Ökologie beim Bauen – etwa durch Recycling-Beton. Von Claus-Jürgen Göpfert, erschienen am 14. Februar 2020 in der Frankfurter Rundschau
„Das Bühnengebäude ist am Ende“
Michael Guntersdorf, Chef der städtischen Stabsstelle, im Interview mit Claus-Jürgen Göpfert, erschienen am 11. Februar 2020 in der Frankfurter Rundschau
„Frankfurt: Zukunft der Städtischen Bühnen“
Meldung, erschienen am 7. Februar 2020 in der Frankfurter Rundschau
Warum es falsch und teuer ist, die Städtischen Bühnen in Frankfurt am Main abzureißen. Kommentar von Laura Weissmüller, erschienen am 6. Februar 2020 in der Süddeutsche Zeitung
„Niklas Mark: ‚Es ist nicht so, dass Frankfurt einen Rem Kohlhaas bekommt“
Hörfunk-Interview: Niklas Maak im Gespräch, erschienen am 3. März 2020 auf HR2
„Ein Zeichen für die nächsten hundert Jahre“
Hörfunk-Interview: Arno Lederer im Gespräch mit Marietta Schwarz, erschienen am 1. Februar 2020 im Deutschlandfunk
„Wehmut und Wahnsinn“
Von Peter von Becker, erschienen am 1. Februar im Tagesspiegel
„Städtische Bühnen Frankfurt: Entscheidung gegen die Sanierung“
Von Sandra Busch, erschienen am 31. Januar 2020 in der Frankfurter Rundschau
„Frankfurter Städtische Bühnen werden abgerissen“
Meldung, erschienen am 31. Januar 2020 in der Frankfurter Rundschau
„Städtische Bühnen werden abgerissen“
Von Michael Hierholzer, erschienen am 31. Januar 2020 in der F.A.Z.
„Abriss und Neubau statt Sanierung“
Meldung, erschienen am 31. Januar 2020 auf nachktirik.de
„Theaterstreit als große Bühne“
Von Christian Thomas, erschienen am 29. Januar 2020 in der Frankfurter Rundschau
Grünen-Fraktionschef Sebastian Popp kann sich beim Bühnen-Neubau einen Eingriff in die Wallanlagen vorstellen, wie er im Interview mit Claus-Jürgen Göpfert und Florian Leclerc sagt, erschienen am 29. Januar 2020 in der Frankfurter Rundschau
„Frankfurt: Eingriff in Wallanlage beim Bühnen-Neubau kein Tabu“
Von Claus-Jürgen Göpfert, Georg Leppert und Florian Leclerc, erschienen am 28. Januar 2020 in der Frankfurter Rundschau
„Frankfurt: Kampf um Wallanlagen bekommt neue Dynamik“
Von Claus-Jürgen Göpfert und Florian Leclerc, erschienen am 28. Januar 2020 in der Frankfurter Rundschau
„Begehrlichkeiten an den Wallanlagen sind geweckt“
Olaf Cunitz im Interview mit Georg Leppert, erschienen m 28. Januar 2020 in der Frankfurter Rundschau
„Wir sollten einen Beirat von Bühnen-Experten gründen“
Baudezernent Jan Schneider im Interview mit Claus-Jürgen Göpfert, erschienen am 27. Januar 2020 in der Frankfurter Rundschau
„Kein Kohlhaas“
Von Niklas Maak, erschienen am 27. Januar 2020 in der F.A.Z.
„Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD): ‘Ein eiskalter und technokratischer Vorschlag’“
Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) zum CDU-Konzept vom Theater am Osthafen in Frankfurt. Im Interview mit Claus-Jürgen Göpfert, erschienen am 26. Januar 2020 in der Frankfurter Rundschau
„Auch Linke fordern Neubau“
Von Claus-Jürgen Göpfert, erschienen am 24. Januar 2020 in der Frankfurter Rundschau
„CDU will Bühnen in Frankfurt für einen sagenhaften Betrag neu bauen – an einem anderen Ort“
Von Claus-Jürgen Göpfert, erschienen am 23. Januar 2020 in der Frankfurter Rundschau
„Frankfurt: Stadträtin rät zu Bühnen-Neubau“
Von Claus-Jürgen Göpfert und Florian Leclerc, erschienen am 23. Januar 2020 in der Frankfurter Rundschau
„Der FR-Kommentar zum Neubau der Städtischen Bühnen“
Von Claus-Jürgen Göpfert, erschienen am 23. Januar 2020 in der Frankfurter Rundschau
„Nicht die Kultur zugunsten des Kapitals aufgeben“
Von Claus-Jürgen Göpfert, erschienen am 23. Januar 2020 in der Frankfurter Rundschau
„Zukunft der Städtischen Bühnen Frankfurt: Koalition ist sich nicht einig“
Von Florian Leclerc, erschienen am 23. Januar 2020 in der Frankfurter Rundschau
„Die Zeichen stehen auf Neubau“
Direkt aus dem dpa-Newskanal, erschienen am 23. Januar 2020
Mit 874 Millionen Euro rechnet die Stadt Frankfurt für den Neubau von Theater und Oper. Es ist gut, wenn sich eine Gesellschaft ihre Kulturbauten viel kosten lässt. Aber wie viel Techno-Luxus muss wirklich sein? Von Niklas Maak, erschienen in der F.A.Z. am 23. Januar 2020
„Grüne wollen Entscheidung zu Städtischen Bühnen“
Von Florian Leclerc, erschienen am 13. Januar 2020 in der Frankfurter Rundschau
„Frankfurt: Keine Resultate zur Zukunft der Bühnen“
Von Claus-Jürgen Göpfert, erschienen am 16. Dezember 2019 in der Frankfurter Rundschau
„Raab Karcher sitzt bis 2033 auf Bühnen-Areal“
Von Claus-Jürgen Göpfert, erschienen am 25. November 2019 in der Frankfurter Rundschau
“Wohin mit den Städtischen Bühnen? Auch die SPD denkt über Osthafen nach“
Von Claus-Jürgen Göpfert, erschienen am 21. November 2019 in der Frankfurter Rundschau
„Städtische Bühnen Frankfurt: CDU bringt neuen Standort ins Gespräch“
Von Claus-Jürgen Göpfert, erschienen am 19. November 2019 in der Frankfurter Rundschau
„Im Dezember Zahlen zur Zukunft der Frankfurter Bühnen“
Von Claus-Jürgen Göpfert, erschienen am 19. November 2019 in der Frankfurter Rundschau
„Kein Geld im Haushalt für neues Kindertheater – Uwe Becker: ‚Städtische Bühnen sind notwendiger’“
Von Claus-Jürgen Göpfert, erschienen am 1. Oktober 2019 in der Frankfurter Rundschau
„Mehr als Oper und Theater: Grüne wollen Willy-Brandt-Platz umgestalten“
Von Judith Köneke, erschienen am 14. August 2019 in der Frankfurter Rundschau
„Bühnen am Willy-Brandt-Platz können saniert werden“
Von Claus-Jürgen Göpfert, erschienen am 20. Juli 2019 in der Frankfurter Rundschau
„Ein Haus für die Ansprüche des 21. Jahrhunderts“
Von Hubert Spiegel, erschienen am 8. Juni 2019 in der F.A.Z (PAYWALL)
Die Bühne der Stadt
// von Sascha Köhl und Helene Bihlmaier //

Theater ist mehr als ein Spiel. Es ist immer auch ein Spiegel gesellschaftlicher Verhältnisse und Auslöser politischer Debatten. Dementsprechend ist auch das Theatergebäude mehr als „nur“ eine Spielstätte. Seit der Zeit der Aufklärung – als auch in Frankfurt das erste Theater der Stadt eröffnet wurde (1782) – dienen Theaterbauten als öffentliche Foren, auf denen die Bürger sich treffen und austauschen, debattieren und auch streiten, über das Schauspiel, die Musik und die Kunst, über politische, gesellschaftliche und viele andere Themen. Das Theater ist daher immer zentraler Bestandteil des städtischen Lebens, und nur wenige Theaterbauten bringen diesen Anspruch so überzeugend zum Ausdruck wie das 1963 eingeweihte Gebäude der Frankfurter Bühnen: durch seine zentrale Lage, seine offene Gestaltung und seine Bedeutung für die städtische Geschichte.
Im Zentrum der Stadt
Seine zentrale Lage verdankt das Gebäude dem Entschluss der Stadtväter des ausgehenden 19. Jahrhunderts, am Standort des heutigen Willy-Brandt-Platzes ein neues Schauspielhaus zu errichten. Der Neubau sollte das zu klein gewordene Theater von 1782, das „Comödienhaus“ am heutigen Rathenauplatz, ersetzen. Man entschied sich damit für den vielleicht prominentesten Ort der Stadt: für jene Stelle, an der die Achse zwischen Römerberg und Hauptbahnhof den Grünzug der Wallanlagen schneidet. So bildet der monumentale, 1902 eingeweihte Neubau des Schauspielhauses ein Pendant zu dem zwei Jahrzehnte zuvor errichteten Operngebäude an der Nordwestecke der Wallanlagen. Während des Kriegs schwer beschädigt, wurde das Schauspielhaus ab 1949 von einer Bürogemeinschaft unter Leitung von Otto Apel wiederaufgebaut – nun allerdings als Opernhaus. Wesentliche Teile des alten Theaters, so auch die Ränge des Zuschauerraums, blieben dabei erhalten. Vollständig neu errichtet wurde vor allem das Bühnenhaus mit der damals größten Drehbühne Europas. Während die Oper damit schon bald nach Kriegsende eine eigene Spielstätte beziehen konnte, musste das Schauspiel vorerst noch mit verschiedenen Provisorien Vorlieb nehmen. Erst 1958 fiel die Entscheidung, neben der Oper ein neues Schauspielhaus zu errichten, wodurch der Theaterkomplex seine heutige Gestalt erhielt. Damit kehrte man gleichsam zu den Anfängen zurück, da bereits das „Comödienhaus“ sowohl dem Sprech- als auch dem Musiktheater eine Spielstätte geboten hatte.
Ein offenes Foyer
Den Auftrag für den zwischen 1959 und 1963 realisierten Neubau der Doppelanlage erhielt das Büro von Otto Apel (seit 1961 ABB: Otto Apel, Hannsgeorg Beckert, Gilbert Becker). Die Architekten errichteten ein Schauspielhaus, das seinerzeit, ähnlich wie zehn Jahre zuvor auch die Opernbühne, den höchsten technischen Ansprüchen genügte. Davon ist allerdings nicht mehr viel erhalten: Nach dem schweren Opernbrand 1987 wurde zunächst das Opernhaus und anschließend, 1991/92, auch das Schauspielhaus umfassend erneuert. Der Zuschauerraum des Schauspiels ist in seinem aktuellen Zustand ebenso das Resultat dieser Baumaßnahmen wie viele weitere, mal mehr, oft weniger passende Einbauten und Eingriffe im Geiste der Postmoderne. In seiner ursprünglichen Struktur und Wirkung weitgehend erhalten blieb glücklicherweise das zweite Hauptelement der 1963 eingeweihten Doppelanlage: das in seiner Gestalt und Aussage zeitlose Foyer. Dieses bildet zum Platz hin eine 120m lange Schaufront aus, die die beiden Häuser von Oper und Schauspiel verklammert. Das Foyer zeigt sich innen wie außen von einer nüchternen, unaufdringlichen Eleganz, geprägt durch eine stringente Gliederung, zu der die Goldwolken Keménys einen Kontrapunkt setzen. Dieses Bauwerk will nicht auftrumpfen, sich nicht selbst ausstellen, sondern, ganz im Gegenteil, vermitteln. Durch sein Ausgreifen in den Platzraum und die Transparenz seiner Außenwände überlagern und verschränken sich die Sphären der Spielstätten und der Stadt. Geht man durch das Innere des Foyers, so zieht es den Blick nach draußen, präsentiert sich die Stadt als Bühne. Steht man vor dem Bau, vor allem abends, wird der Blick unweigerlich hineingezogen, wird das beleuchtete Foyer zur Bühne, auf der die Diskussionen der Besucherinnen und Besucher als wesentlicher Bestandteil des Theaters inszeniert werden.

Zeugnis städtischer Geschichte – Symbol für eine neue Zeit
Das offene Foyer soll aber nicht nur einladend wirken, nicht nur Blicke anziehen und Neugier wecken. Weit mehr als das: Als Schauseite eines wichtigen öffentlichen Gebäudes im Herzen einer Stadt, die auch um 1960 noch vielerorts vom Krieg gezeichnet war, hatte der Bau auch eine Symbolfunktion. In seiner offenen, filigranen und trotz seiner Größe gerade nicht überwältigenden Gestalt bildet das Gebäude – ähnlich wie viele andere öffentliche Bauten der jungen Bundesrepublik – ein Gegenmodell zur massiven, überdimensionierten Einschüchterungsarchitektur der NS-Zeit. Auf diese Weise verkörpert es den kulturellen, politischen und gesellschaftlichen Aufbruch eines sich neu erfindenden Landes und seiner heimlichen Hauptstadt. Dies gilt umso mehr, als das Bühnengebäude vielleicht das einzige, vor allem aber das wichtigste öffentliche Bauvorhaben jener Zeit im Stadtzentrum war, das diesen Neubeginn veranschaulichen konnte und sollte. Repräsentierte der wiederaufgebaute Römer die stolze, jahrhundertealte Geschichte kommunaler Selbstbestimmung, so stand das neu errichtete Bühnengebäude für eine neue Ära bürgerlicher Mitbestimmung, gesellschaftlicher Offenheit und künstlerischer Freiheit.
Das Gebäude ist daher nicht nur ein Ort, an dem Theatergeschichte geschrieben wurde, sondern auch ein Denkmal, das wie kein zweites für eine grundlegende, aber zunehmend aus dem Stadtbild getilgte Epoche der städtischen Geschichte steht. Nicht zuletzt ist es ein Sinnbild für Ideale und Werte, die nach wie vor das Fundament unseres Gemeinwesens bilden und für die es gerade in diesen politischen Zeiten mehr denn je einzustehen gilt. Der – wenigstens partielle – Erhalt des Bühnengebäudes wäre daher ebenso ein Zeichen eines verantwortungsvollen Umgangs mit der Geschichte wie auch ein Signal für eine bescheidenere, nachhaltigere Baupolitik der Zukunft.
Sanierung oder Neubau
Im Januar beschloss die Frankfurter Stadtverordnetenversammlung, für die städtischen Bühnen einen Neubau zu errichten und das bestehende Gebäude aufzugeben. Zu dieser umstrittenen Entscheidung kam es nach einem neun Jahre langen Prüfprozess, in dem zwar bautechnische Fragen intensiv untersucht worden sind, bei dem aber die Frage nach der zukünftigen Theaterkonzeption und dem Denkmalschutz weitestgehend vernachlässigt wurden.
Nachdem immer wieder neue Sanierungsmaßnahmen an der Theaterdoppelanlage von ABB Architekten von 1963 erforderlich wurden, forderte im Sommer 2011 das Revisionsamt der Stadt Frankfurt am Main zur Beendung des fortgesetzten Stückwerks ein Gesamtsanierungskonzept, welches 2013 dann auch in Auftrag gegeben wurde. Ein Planerkonsortium unter der Leitung von BMP Baumanagement GmbH Köln unter Beteiligung des Architekturbüros PFP (Jörg Friedrich Hamburg) erstellte in den Jahren 2014 – 2017 für € 6,5 Mio. diese Machbarkeitsstudie.
Als sich bereits im Sommer 2016 eine Verdreifachung der ursprünglich auf € 130 Mio. geschätzten Kosten andeutete, brachten Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) und Bürgermeister Uwe Becker (CDU) erstmals die Möglichkeit eines Neubaus ins Spiel. Das fertige Gutachten bezifferte die Kosten für Sanierung oder Neubau dann sogar auf 850 – 890 Mio. €, die Kosten für die Interimsspielstätten je nach Variante auf 20 – 70 Mio. €.
Der ehemalige Baudezernent Hans-Erhard Haverkampf (SPD) widersprach wenige Wochen nach Veröffentlichung den Aussagen des Gutachtens und hielt eine Sanierung im Rahmen der einst von der Kämmerei geschätzten Kosten für möglich, wie er in einer 27-seitigen Expertise darlegte. Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) suchte nun nach Einsparmöglichkeiten, während sich Baudezernent Jan Schneider (CDU), um u.a. die Interimskosten zu sparen, für die Option eines Neubaus an anderem Standort aussprach, die auch vom Regionalteil der Frankfurter Allgemeinen Zeitung propagiert wurde.
Im April 2018 beauftragte die Stadtverordnetenversammlung den Magistrat mit weiteren Untersuchungen, der hierfür im Oktober 2018 eine Stabsstelle einrichtete. Ergänzend zu einer Fortsetzung der Beauftragung von Autoren der Machbarkeitsstudie wurde im Frühjahr 2019 ein Evaluierungsteam beauftragt. Am 23.1.2020 stellte Kulturdezernentin Ina Hartwig eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse der Presse vor. Neben Sanierung bzw. Neubau am bisherigen Standort war nun auch die Option eines Neubaus an anderem Standort untersucht worden. Trotz Verzicht auf einige von Hans-Erhard Haverkampf als unnötig kritisierten kostentreibenden Vorgaben sah man nun bei allen Varianten Kosten von 810 – 920 Mio. € als gegeben an, wobei eine Sanierung des Bestandes mit den höchsten Kosten verbunden sei. Anders als 2017 wurden die Gutachten aber diesmal nicht veröffentlicht. Bereits eine Woche später entschied sich die Stadtverordnetenversammlung gegen eine Sanierung des bestehenden Theaterbaus und legte sich auf einen Neubau fest. Wo dieser realisiert werden sollte, ist allerdings bislang völlig offen. Die CDU präferiert einen Neubau am Osthafen auf dem Betriebsgelände von Raab Karcher, SPD und Grüne hingegen einen Opernneubau in der Wallanlage gegenüber den heutigen Städtischen Bühnen und einen Neubau des Schauspielhauses am alten Standort. Im Gespräch als mögliche Standorte sind auch die Wallanlage gegenüber der Alten Oper sowie der Kulturcampus an der Bockenheimer Warte.
Die Initiatoren dieser Website kritisierten Anfang März den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung und plädierten dafür, das Wolkenfoyer und nach Möglichkeit auch Bühne und Zuschauerraum der Oper zu erhalten. Dies wäre etwa im Rahmen eines Teilabrisses und -neubaus möglich.
Ende März 2020 verkündete Oberbürgermeister Peter Feldmann angesichts der Kosten der Corona-Pandemie die Verzögerung der Investitionsentscheidung, die etwa ein Viertel des jährlichen Budgets der Stadt Frankfurt erfordern würde: „Zuerst muss die Stadt wieder auf die Beine kommen.“
Wolken retten! „Blechbichsen“ und andere Kunstobjekte
von Alfons Maria Arns


Integraler Bestandteil der 1963 eröffneten Theaterdoppelanlage sind jene drei Kunstwerke namhafter Künstler, die im Zusammenhang mit dem Neubau als „Kunst am Bau“-Projekte von der Stadt Frankfurt in Auftrag gegeben wurden: die Wolken (1963) des ungarischstämmigen Künstlers Zoltán Kemény (1907-1965), das Großgemälde Commedia dell’arte (1958/59) von dem Maler und Grafiker Marc Chagall (1887-1985) und schließlich die Bronzeskulptur Standing Figure: Knife Edge des englischen Bildhauers und Zeichners Henry Moore (1898-1986).
Während die riesige Deckenskulptur Wolken mit ihrem illusionistischen sphärischen Schweben im scharfen Kontrast das nüchterne Foyer ausfüllt, wirkt das ungemein farbige zirkusartige Welttheatergemälde Commedia dell’arte, im Saal zwischen Theater und Oper platziert, wie ein Bühnenbild, das einen Vorschein dessen gibt, was auf der Bühne passiert. Die Bronzeskulptur Knife Edge dagegen nimmt direkten Bezug auf einen stehenden menschlichen, spiralartig verdrehten Körper; jenes „Material“, das auf der Bühne von Sprech- und Musiktheater erst noch der Formung bedarf.
Einen ersten Eindruck dieser „Kunst im Bau“ vermittelt die zur Eröffnung erschienene, vom damaligen Amt für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung der Stadt Frankfurt am Main herausgegebene Broschüre Zoltan Kemeny Deckenskulptur im Frankfurter Theaterfoyer (mit Fotos von Trebor, d.i. der Fotograf Horst Robert Kratzmann und Essays von dem Architekten Hannsgeorg Beckert, dem damaligen Generalintendanten Harry Buckwitz, dem Künstler Z. Kemeny und dem Kunsthändler und damaligen Direktor des Frankfurter Kunstvereins Dr. Ewald Rathke).
Die Broschüre zeigt eindringlich, dass mit dem geplanten Abriss nicht nur die Architektur, sondern auch die Kunstobjekte selbst und ihr angestammter Platz bedroht sind.
Die Abrissentscheidung vom 30.1.2020
Am 30.1.2020 beschloss die Frankfurter Stadtverordnetenversammlung auf Antrag der regierenden Römerkoalition (CDU, SPD, GRÜNE), die bestehende Theateranlage am Willy-Brandt-Platz von ABB Architekten durch einen Neubau zu ersetzen. Der Beschlussantrag weist eine Begründung von sieben Zeilen auf und wurde in den Fachausschüssen für Kultur und Planung nicht vorab behandelt, obwohl beide 14 Tage zuvor getagt hatten.
Download Beschlussantrag
Der Antrag für den Grundsatzbeschluss zu dem Milliardenprojekt war den Abgeordneten erst am selben Tag kurz nach 10 Uhr bekannt gemacht worden und wurde in der nur sechs Stunden später beginnenden Stadtverordnetenversammlung verabschiedet. Für ihren Beschluss lagen den Stadtverordneten nur die 5-seitige Presseinformation sowie die dazugehörigen Präsentationsfolien der Pressekonferenz vom 23.1. vor, was auch mehrere Abgeordnete in der Debatte beklagten.
Download Wortprotokoll der Sitzung
Download Presseinfo vom 23.1.2020
Download Vorstellung der Ergebnisse als Präsentation vom 23.1.2020
Lesen Sie auch:
Man will doch nur spielen
Die unendliche Baugeschichte der Städtischen Bühnen
Der Architekturkritiker Dieter Bartetzko (1949-2015), langjähriger Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, schrieb zum 50-jährigen Jubiläum der Theaterdoppelanlage 2013 diesen Essay, der einen Rückblick auf die Baugeschichte des Frankfurter Theaters seit ihrer Gründung 1872 gibt.
Vom Komödienhaus zum Kunsttempel: Frankfurts erstes Schauspielhaus
Wenn sie auf ihrem Logensitz in der „Erregung des Herzens“ um Luft ringe, so schrieb einst Goethes Mutter über ihre grenzenlose Liebe zum Theater, dann könne es geschehen, dass ein biederer Nachbar ihr zuraune: „Sie spielen’s ja nur.“ Schauplatz dieses Ringens zwischen Lakonik und Enthusiasmus, Nüchternheit und Leidenschaft war das legendäre Komödienhaus am heutigen Frankfurter Rathenauplatz. „Mit Ehrfurcht“, so zitiert Waldemar Kramers Frankfurt-Chronik (1964) das Tagebuch eines Zeitgenossen, „tritt man in das mit lauter Glaskugeln beleuchtete Parterre, himmelblau gemalt, mit goldenen Verzierungen und mit Scharlach ausgeschlagen. Das neue Komödienhaus im holländisch-französischen Geschmack macht in der That den Frankfurtern Ehre.“
Der entzückende klassizistische Bau von Stadtbaumeister Johann Andreas Liebhardt war am 3. September 1782 eröffnet worden, erlebte zwei Jahre später die spektakuläre Uraufführung von Schillers Kabale und Liebe, 1788 die des Don Carlos und blieb, eine kunsthistorische Kostbarkeit, bis zur Eröffnung des neuen Schauspielhauses 1902 in Benutzung. Von da an stand das Kleinod, seitens der Denkmalpflege immer wieder als unverzichtbar gewürdigt, acht Jahre lang leer, um schließlich in schönstem Frankfurter Kaufmannspragmatismus abgerissen zu werden. An seiner Stelle entstand in Windeseile ein monumentaler, für die Ära charakteristischer Kolossalsäulenbau – ein Geschäftshaus, versteht sich.
„Frankfurt fährt selten aus – aber wenn, dann vierspännig“: Das zwischen Selbstzufriedenheit und Selbstironie changierende geflügelte Wort des 19. Jahrhunderts hatte einen Kronzeugen im neuen Schauspielhaus, das man sich 1902 leistete. Den Ruhm des Frankfurter Opernhauses von Richard Lucae vor Augen, bei dessen Einweihung 1880 Kaiser Wilhelm I. ein „Das hätte ich mir in Berlin nicht erlauben können“ entschlüpft war, hatte man 1899 den vielversprechenden Berliner Theaterarchitekten Heinrich Seeling mit dem Entwurf eines neuen spektakulären Sprechtheaters beauftragt. Er legte Zeichnungen vor, auf denen die Großform mit exotisch unterfütterter Neorenaissance und einem freien Zitat der Berliner Reichstagskuppel staatstragende Bedeutung signalisierte, während Jugendstildetails dezent den Willen zur Moderne andeuteten.
Hätte man (was Frankfurts notorischer Pragmatismus ausschloss) zuvor noch Bedenken gehabt, für den Neubau an der Untermainanlage eines der schönsten klassizistischen Gebäude Frankfurts, das vom französischen Hofbaumeister Salins de Montfort 1820 errichtete Palais Grunelius, abzureißen – die ostentative Pracht von Seelings Entwurf hätte sie zerstreut. Oder ließ das renditeträchtige Nutzungskonzept die wenigen Stimmen verstummen, die den Erhalt des kostbaren Salins-Baus forderten? Seelings Pläne verbanden nämlich das Theater mittels einer eleganten doppelreihigen Säulenarkade samt „Lustgarten“ mit einem extravaganten Mietshaus, in dessen Erdgeschoss ein „gehobenes Wein- und Bierrestaurant“ mit dem sprechenden Namen „Faust“ residieren sollte.
Nicht nur die Größe, sondern auch und vor allem sein Stil unterschied das neue Schauspielhaus fundamental von seinem historischen Vorgänger: Heinrich Seelings ganz auf das internationale Anspruchsniveau zugeschnittene Mischung aus Neorenaissance und Jugendstil bedeutete den endgültigen Abschied Frankfurts von den eigenen Bautraditionen. Bis weit in das 19. Jahrhundert hinein hatte die Stadt an überlieferten Baumaterialien wie dem roten und beigen Sandstein und dem berühmten „Frankfurter Klassizismus“ festgehalten. Eben noch war in Architektur-Magazinen anerkennend vom Frankfurter Sonderstil die Rede gewesen, nun gab man sich metropolitan – und übersah, dass zur selben Zeit das deutsche Bühnengenie Max Reinhardt die klassizistische Umgestaltung seiner Berliner Theater vorbereitete. 1905 war es so weit: Dem Deutschen Theater wurde vom Architekten William Müller eine nobel-schlichte neoklassizistische Fassade und ein Foyer in Neo-Empire gegeben; 1906 folgten die Kammerspiele, für die Müller eine Friedrich Gillys Klassizismus nachempfundene Front und einen zwischen Jugendstil und Sachlichkeit oszillierenden Zuschauerraum gestaltete. Mit einem Schlag wirkte der Stil des Frankfurter Schauspielhauses altbacken.
Doch davon blieb das Frankfurter Publikum vorerst unberührt. Man war stolz auf die Schaufassade mit zwei aus Turm und Obelisk gemischten Risaliten, zwischen denen ein breitgelagertes dreigeteiltes Säulenpfeilerportal mit Balkon und Auffahrt vorsprang, überfangen von drei hohen, wie Monumentalnischen eingetieften Rundbogenfenstern, über denen ein mächtiges, mit Reliefs verziertes dreieckiges Giebelfeld lagerte; das Arrangement trumpfte auf wie die Theaterfassaden in Paris und Wien, Brüssel und London.
Auch die Stirnseiten der spiegelbildlich angefügten Seitentrakte entfalteten mit Blendnischen samt überlebensgroßen allegorischen Statuen und Büsten großstädtisches Gepränge. Vergleichsweise spröde dagegen gaben sich die statuenlosen, einzig durch Fensterbögen und Pilaster geschmückten Seitenfronten – verschmerzbar, da hoch über ihnen die gigantische Kuppel des Bühnenturms jedermann signalisierte, dass im Inneren eine der breitesten und technisch bestausgerüsteten Bühnen Europas die Zuschauer erwartete. Auf dieser Kuppel, die, wie eingangs gesagt, entfernt an Paul Wallots Berliner Parlamentshaube erinnerte, reckte sich auf einem ornamentstrotzenden Säulenpavillon Melpomene, die Personifikation der Tragödie.
Überhaupt setzten der Architekt und die Bauherren mittels einer ausgeklügelten Ikonographie das konservative Kunst- und Kulturverständnis ihrer Zeit aufwendig in Szene: Den Giebel des Empfangstrakts schmückte der italienischstämmige Bildhauer Augusto Varnesi, der zuvor lange am Figurenprogramm des Reichstags beschäftigt gewesen war, mit den Reliefdarstellungen von Tragödie und Komödie. Die Seitentrakte dekorierten Figurengruppen zum Thema „Dichtung“ und „Rhetorik“, flankiert von Monumentalbüsten der Nationaldichter Goethe und Schiller.
Auch wenn die Ähnlichkeit des Bühnenturms mit der Berliner Reichstagskuppel Vaterländisches ausstrahlte, war doch die Hauptwirkung des Schauspielhauses eine eher paneuropäische: Die Fassadenskulpturen verwiesen auf das humanistische Renaissance-Florenz, und eine geflügelte Sphinx auf dem Dachfirst über dem Empfangstrakt, die mit aufgerichtetem Haupt hinunter auf das eintretende Publikum und zugleich in unermessliche Fernen zu starren schien, stand für das archaische Griechenland und damit den Ursprung der europäischen Kultur und Bühnenkunst. Als Allegorie aller Geheimnisse, die das Theater bewahrt und offenbart, war sie nicht nur die symbolische Hüterin der Tradition, sondern zugleich so etwas wie die unerkannte, von Sigmund Freud gesandte Vorbotin der Stücke eines Strindberg, Ibsen oder Hauptmann, deren „Nerventheater“ bald auch auf Frankfurts Bühne die Moderne in ihr Recht setzen sollte.
Die Bekrönung der turmartigen Frontrisalite, zwei Schwäne, die unsereins unwillkürlich für stramme preußische Adler hält, waren gleichfalls alles andere als Geschöpfe der wilhelminischen Pickelhauben-Mentalität: Im griechischen Mythos Attribut der Aphrodite, im germanischen den Walküren beigesellt, in beiden Kulturen auch als Seelengeleiter verstanden, sollten sie am Frankfurter Theater Schönheit, Anmut und Reinheit vertreten; sinnliche Entsprechung von Goethes sprödem „Dem Wahren, Schönen, Guten“, das am Giebel der Frankfurter Oper prangte.
Die heute populärste Figur des Schauspielhauses (es wird noch darauf zurückzukommen sein) war beziehungsweise ist die von Franz Krüger geschaffene Bronzegruppe Thalia auf einer Pantherquadriga über dem Zentralgiebel. Ihr Vorbild war möglicherweise die Quadriga des Bildhauers Johannes Schilling, die seit 1878 auf dem Giebel der Dresdner Semperoper Dionysos und Ariadne als Patrone der Theaterkunst präsentiert. Mit der Wahl Thalias, der Muse der komischen Dichtung und der Unterhaltung, trug man vermutlich in Frankfurt der Bestimmung des Hauses als Spielort auch von Komödien Rechnung.
Einige Jahre nach Eröffnung des Schauspielhauses, nämlich 1910, trat mit dem sofort ungemein beliebten „Märchenbrunnen“ endgültig der Jugendstil in sein Recht, gepaart mit einer aufschlussreichen Volkstümlichkeit: Kurz zuvor hatte man beim Neubau des Frankfurter Rathauses an den Fassaden nicht nur die Statuen verdienter Honoratioren, Wissenschaftler und Künstler aufgestellt, sondern auch Abbilder stadtbekannter Originale, beispielsweise zwei „Kannix“ und „Habnix“ titulierte Schnorrer, einige der schlagfertigen Marktfrauen aus Sachsenhausen und einen vorwitzigen, von der Obrigkeit gefürchteten Journalisten.
Frankfurt, auf dem Weg von der Patrizierrepublik zur sozialdemokratischen Stadt, entdeckte und verewigte seine Zuneigung fürs „Volkstümliche“. Folgerichtig posierte ab dem August 1910 neben der Schaufront des Schauspielhauses über einer vegetabil bootsartigen Brunnenschale, die der Mäzen Leo Gans gestiftet hatte, nicht Apollo oder die tragische Muse Melpomene, sondern, nackt wie Bildhauer Friedrich Christoph Hausmann sie schuf, die Personifikation des Märchens; nach den Regeln der Ikonografie würde man sie als Nymphe bezeichnen. Das Frankfurter Publikum ernannte die Statue aus weiß glitzerndem Tiroler Marmor sofort zum „Mainweibchen“ – und hielt ihr bis in unsere Tage über alle Stilwechsel der Kunst hinweg die Treue. So sehr, dass 2005 und 2006 die bronzenen Putten, Fische und Eidechsen, die im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen worden waren, anhand historischer Fotografien rekonstruiert und erneut zu Füßen der Nymphe aufgestellt wurden.
Ein entscheidendes Detail aber fehlt dem Brunnen seit seinem Wiederaufbau 1951: die halbrunde steinerne Sitzbank, die nach antiken Vorbildern als noble Exedra gestaltet worden war. Dass selbst 2006, als Stadtraumplaner grübelten, wie man den Vorplatz des Theaters zur Verweilzone machen könne, niemand auf die Idee kam, die bis zur Zerstörung 1944 täglich umlagerte Sitzbank wiederherzustellen, wirft ein bezeichnendes Licht auf die momentane Unfähigkeit, den öffentlichen Raum publikumsfreundlich zu gestalten.
Zurück ins Jahr 1911: Die nun vollendete subtile Mischung aus mondänen und volkstümlichen Elementen, wie sie das Äußere des Schauspielhauses prägte, trat im Inneren hinter die eher konventionelle Ausgestaltung zurück. Das Foyer entsprach mit dezenter Neorenaissance den allgemeinen Erwartungen; der Zuschauerraum mit seinem breiten Parkett und drei Rängen erfüllte die Norm großer Stadttheater, nicht mehr und nicht weniger. Doch der rasante, zwischen konvex und konkav schillernde Jugendstilschwung der Ranganordnung – er hat sich über alle radikalen Umbauten bis heute erhalten – verlieh dem Riesenraum eine eigene, unverwechselbare dynamische Note.
Dieser sozusagen zukunftsfrohe Sturm und Drang des Jugendstils sprang in den folgenden Jahren auf das Repertoire über. Zu dessen Höhepunkten zählte 1911 die Premiere – die Uraufführung hatte man misstrauisch der Hauptstadt Berlin überlassen – von Carl Rösslers Die fünf Frankfurter. Als die Berliner Kritiken aber erkennen ließen, dass die mit tragischen Untertönen versehene Mundartkomödie über die fünf Gründerbrüder des legendären Frankfurter Bankhauses Rothschild neben den Schwächen auch die Tugenden der lokalen Handels- und Banken-Elite feierte, war man begeistert.
Erfolgreich an die Frankfurter Liberalität appellierend, gelang es nach dem Ersten Weltkrieg den Leitern des Schauspielhauses, Frankfurts Bühne neben Berlin zu einem Zentrum des umstrittenen expressionistischen Theaters und zur Talenteschmiede für Autoren und Schauspieler zu machen. Experimentierfreudig wie das Theater zeigte sich damals auch das städtische Bauen: Binnen zehn Jahren schuf Ernst May das „Neue Frankfurt“. Zwar konnte er seinen radikalen Funktionalismus vorwiegend nur in Gestalt von Trabantensiedlungen verwirklichen. Doch in der Innenstadt ließen sich einige Bauherren von seinem Bekenntnis zum ornamentlosen Kubismus mitreißen. Wie in Berlin wurden auch in Frankfurt die opulenten Gründerzeitfassaden im Zentrum bereinigt. „Fort mit Schnörkel, Stuck und Schwaden. Glatt macht man jetzt die Fassaden“, spöttelte 1928 im Berliner Theater am Kurfürstendamm die Revue Es liegt in der Luft! Im selben Jahr entdekorierte Ernst Mays Assistent Martin Elsässer das pompöse Palmengarten-Gesellschaftshaus und gab ihm eine pathetisch-asketische Fassade à la de Chiricos Pittura metafisica.
Ob May und seinem Stab Ähnliches für das Schauspielhaus vorschwebte, ist unbekannt. Mit der Emigration des Stadtbaurats in die Sowjetunion 1930 und dem Ausbruch der Weltwirtschaftskrise kam alles Bauen zum Stillstand. So setzte einzig das legendäre Café Rumpelmeyer, schräg gegenüber der Schauseite des Schauspielhauses gelegen und die Frankfurter Ausgabe des „größenwahnsinnigen“ Berliner Romanischen Cafés, mit seinem neusachlich gestalteten, dem Theater zugewandten Wintergarten ein kleines Zeichen der Moderne.
Denkbar ist, dass die Nationalsozialisten über kurz oder lang das Schauspielhaus gemäß ihrer Architekturideologie so entdekoriert hätten wie 1938 das Berliner Schillertheater. Doch statt Presslufthämmern einer „Stilbereinigung“ rückten Sprengbomben dem Bauwerk zu Leibe – am 29. Januar 1944 brannte Frankfurts Theater aus, blieb aber in seiner Grundsubstanz und dem Äußeren weitgehend erhalten.
Fort mit Schnörkel und Stuck
Schon 1948, im selben Jahr, in dem die wiedererrichtete Paulskirche mitten in der Trümmerwüste der Altstadt eröffnet wurde, fiel die Entscheidung, das Schauspielhaus wiederaufzubauen. Eine bewundernswerte Tatkraft und ein imponierender Idealismus angesichts der weitflächigen Zerstörungen und Tausender Obdachloser. Doch der Eindruck relativiert sich, wenn man die Umstände näher betrachtet: Frankfurts provisorischer Magistrat verzögerte die Aufräumarbeiten am Theater. Als Beschwerden der Bevölkerung laut wurden, dass man zwar die Dächer und Heizungen der Rathausbauten erneuere, Schulen und Kindergärten aber unterversorgt blieben, ließ man zeitweise die Arbeiten ganz ruhen.
Doch dieselben Bürger, die anfangs polemisiert hatten, protestierten, als im Januar 1950 die Stadtverordnetenversammlung den Wiederaufbau des Schauspielhauses gänzlich stoppte. „Allem voran“, so die offizielle Begründung, „geht die Sicherung der nackten Existenz unserer Mitbürger. Dazu gehört in erster Linie die Beschaffung von Wohnraum.“ Was folgte, ging als „Frankfurter Theaterkrise“ in die Geschichte der Stadt und der jungen Bundesrepublik ein: Eine Unterschriftensammlung des damaligen Schauspieldirektors Richard Weichert, bei der 50 000 Bürger den Fortbestand der Bühne forderten, gab schließlich den Ausschlag, dass im Oktober 1950 die definitive Entscheidung für einen zügigen Wiederaufbau fiel. Ihre Schattenseite: Das Theater wurde zur Spielstätte der Oper bestimmt, weil Lucaes Opernhaus, das bald darauf den makabren Ehrentitel „Schönste Kriegsruine Deutschlands“ erhalten sollte, in unverbesserlichem frankfurterischem Behörden-Pragmatismus für rettungslos verloren erklärt und zum Ausschlachten durch Schrotthändler freigegeben worden war.
Für das Schauspiel wurde der ihm 1946 als Provisorium zugeteilte Börsensaal einstweilen zum Dauerrefugium. Dass man damit nur wenige Schritte entfernt vom Standort des einstigen Komödienhauses spielte, dürfte niemandem bewusst und, wenn doch, dann kein Trost gewesen sein.
Frankfurt im Jahr 1953: An der Friedensbrücke steht immer noch das Sperrholzschild, auf das witzelnde GIs den Schriftzug „Chicago am Main“ gepinselt haben. Vielen Bürgern, vor allem aber dem Magistrat, ist der Witz längst Ernst: Hinter der Hauptwache wächst, gestaltet nach Hochhaus-Vorbildern in Chicago, der Fernmeldeturm, einige Schritte weiter entsteht das Rundschau-Haus, dessen gläserne „Runde Ecke“ Erich Mendelsohns berühmtes Berliner Mosse-Verlagshaus von 1920, aber auch H. L. Sullivans legendären Schlesinger and Mayer Store in Chicago zitiert. Und am zentralen Kaiserplatz, wo Rosemarie Nitribitt ihre Runden zu drehen beginnt, kreiselt im gläsernen Treppenhaus-Zylinder an der Stirn des Juniorhauses eine der schärfsten Wendeltreppen der jungen Republik.
Frankfurt wähnt sich auf dem Weg zur „modernsten Stadt Europas“. Wer damals vom Rossmarkt her auf das Juniorhaus schaut, sieht dahinter den Bühnenhaus-Kubus des Schauspielhauses aufragen. Nichts mehr von Reichstagsprunk ist an ihm zu erkennen, stattdessen bietet er sich sachlich-nüchtern als reiner Zweckbau mit Satteldach. Die übrige äußere Hülle zeigt nahezu unversehrt den Vorkriegszustand; ramponiert ist lediglich das angrenzende Mietshaus mit dem Restaurant Faust, das dennoch weiterhin als Theatertreff floriert.
Ein entscheidendes Detail aber haben der städtische Oberbaurat Ueter und das Architekturbüro Apel, die für den Wiederaufbau verantwortlich zeichneten, verändert: Der Haupteingang zeigt keine Säulen und keinen feierlichen „Erscheinungsbalkon“ mehr. Stattdessen öffnen – das Gleiche hat Ferdinand Kramer am Säulenportal der Goethe-Universität gemacht – gläserne Schwingtüren den Blick in das Vestibül; der Balkon ist diskreten Austritten mit hauchdünnen Brüstungsgittern gewichen, und wie die Portale sind auch die drei Rundbogenfenster über ihnen bis auf Fußbodenniveau verglast, so dass abends ungehindert in das Foyer geschaut werden kann – Transparenz, die seit Hans Schwipperts Glaswand im Parlamentssaal des Bonner Bundestags als Zeichen der Demokratie und ihrer Durchlässigkeit gilt.
Das Innere hat das Frankfurter Architektengremium einer radikalen Entkernung – brutal gesagt: einer Ausschabung – unterzogen. Nur die statisch unverzichtbaren Elemente sowie tragende Wände sind geblieben, ertüchtigt, neu verputzt, geweißt. Über diese sozusagen abstrakten „urgeometrischen“ Volumina, die für sich betrachtet durchaus so eindrucksvoll wie beispielsweise die ebenso entdekorierten Innenräume des Würzburger Doms oder der Münchner Michaelskirche hätten wirken können, zogen jedoch Dekorateure eine Art betulichen Plüschschleier – Volants und Draperien, Schnörkelleuchten und geschwungene Gesimse verbreiteten eine zwischen Gelsenkirchener Barock und Gutsherren-Eleganz schwankende Atmosphäre, wie sie in vielen Repräsentationsräumen jener Ära, von Konrad Adenauers Arbeitszimmer im Bonner Palais Schaumburg über die benachbarte Villa Hammerschmidt des Bundespräsidenten bis hin zum Gästehaus der Regierung auf dem Petersberg, gang und gäbe war.
Wie 50 Jahre zuvor lagen damit auch 1953 Welten zwischen der Erscheinung und der Technik des Hauses: Die neue, 38 Meter breite Drehbühne war seinerzeit die größte und modernste Europas.
Dass nicht nur Geld und Politik das Leben bestimmen
1962, ein Jahr ehe der damalige Kanzler Erhard mit seinem bedingungslos modernen, gläsernen Kanzlerbungalow die bundesdeutsche Öffentlichkeit in zwei konträre Geschmackslager spaltete, donnerten an und in Frankfurts Schauspielhaus die Presslufthämmer. Sie führten aus, was seit dem 13. November 1956 die Arbeitsgemeinschaft Apel-Kuhnert-Ueter im Auftrag der Stadt entworfen hatte: die Vorarbeiten für eine Theaterdoppelanlage, in der Oper, Schauspiel und Kammerspiel, vereint hinter einer durchgehenden Glasfassade, den Spielbetrieb gewährleisten sollten.
Begleitet vom Abriss mehrerer Wohnhäuser an der Neuen Mainzer Straße sowie des Faust-Restaurants und der Planierung des Faust-Gartens samt seiner Säulengänge, gingen die vollständige Beseitigung der historischen Fassaden und die abermalige Entkernung des Inneren vonstatten. All dies weckte nicht nur Begeisterung bei den Bürgern. Empört reagierte man schließlich, als vor dem inzwischen trostlosen Bauwerk die ramponierten Monumentalbüsten Goethes und Schillers auf dem Bürgersteig auf ihren Abtransport warteten.
Der Magistrat beschwichtigte die zunehmenden Beschwerden mit der Zusage, sämtliche Statuen und Reliefs des alten Schauspielhauses würden sorgfältig ausgebaut, verwahrt und bei passender Gelegenheit wiederverwendet. Was davon zu halten war, sollte sich erst 20 Jahre später herausstellen, als während des Wiederaufbaus der Alten Oper ein Journalist der Frankfurter Rundschau die Plastiken Thalias und ihrer Pantherquadriga auf dem Lagerplatz eines Schrotthändlers am Rand der Stadt entdeckte. Die Figurengruppe wurde zurückgekauft und als Ersatz für den 1944 in der Brandhitze geschmolzenen (vielleicht aber auch erst 1951 als Altmetall entsorgten) Apollo auf den Vestibülgiebel der Alten Oper gestellt. Die übrigen Skulpturen des Schauspielhauses aber blieben – mit einer Ausnahme, über die noch zu sprechen sein wird – unauffindbar; versunken im Meer der notorischen magistralen Gleichgültigkeit.
1961 übertönte der allgemeine Jubel nicht nur die Bedenken über den Verlust des alten Theaterbaus, sondern auch die vereinzelten Einwände gegen den gleichzeitigen Abriss des Schumanntheaters am Hauptbahnhof; der 1905 von den Berliner Architekten Friedrich Kristeller und Hugo Sonnenthal in glamourösem Jugendstil errichtete Varietépalast war längst als architektonische Kostbarkeit erkannt, hatte aber gegen die Gewinnaussichten des öden Bürohauses, das an seine Stelle trat, keine Chance: Frankfurt, vor allem sein Magistrat und seine Baudezernenten, schwelgte unter dem Stichwort „International Style“ in einem fulminanten Glas- und Funktionalismus-Rausch.
Neben der Ruine der Alten Oper wuchs, allgemein bewundert, ab 1960 das Zürich-Hochhaus am Rand des Rothschild-Parks. Mit dessen „Sandwich-Brüstungen“ aus blau emailliertem Glas, gehalten und senkrecht gegliedert von Trägern, die mit silbernem Aluminiumblech überzogen waren, übertrug der Zürcher Architekt Werner Stücheli neueste amerikanische Trends nach Frankfurt. Das Gleiche galt für das Hochhaus der Schweizer National, das, entworfen vom hiesigen Büro Meid und Romeick, ab 1962 direkt hinter dem Rohbau der neuen Theaterdoppelanlage am Mainufer in die Höhe stieg; 15 gläserne Büroetagen, eingehängt in fünf den Turm rechtwinklig umspannende, schlanke Betonbügel, die mit Kupferblech verkleidet wurden. Dass eine immer stärker werdende, (vorerst noch) freudige Ahnung von Manhattan durch die Stadt zog, bewirkte zudem der Rohbau der BHF-Bank wenige Schritte vom Zürich-Hochhaus entfernt. Seit 1960 baute Sep Ruf, der Architekt des gläsernen Kanzler-Bungalows, diesen Bankenturm als optisch schwerelosen, vom reizvollen Widerspiel zwischen weißgrauen Marmorbrüstungen, Glaswänden und filigranem silbrigem Trägergerüst geprägten Vierkant.
Als 1963 dann die Baugerüste an der neuen Theaterdoppelanlage fielen, taten sich anfangs selbst eingefleischte Anhänger des International Style schwer mit dem neuen Äußeren. So radikal wie die Schaufront von Apel/Beckert/Becker hatte von Münster bis Düsseldorf, Mannheim bis Köln noch kein Theaterneubau jegliche Repräsentation verweigert. Nahtlos spannte sich, nur rhythmisiert von Rechteckstützen, die mit Aluminium verkleidet waren, eine neutrale Glasfläche 120 Meter in die Waagerechte.
Unter ihrer weiten Auskragung verschwanden die Zugänge zu Oper und Schauspiel – noch während der Bauarbeiten hatte man die ursprünglich geplanten festlichen Baldachine, die, für die Oper halbrund, für das Schauspiel waagerecht, auf die Portale zuführen sollten, aus Verkehrsgründen gekappt. Selbst die Dachterrasse, die über dem dritten Rang der Oper das kleine, zusätzliche zweite Foyer nach draußen verlängerte, trat hinter die Fassade zurück; was Wunder, dass einige Spötter von Theaterfabrik sprachen.
Noch spröder gaben sich die Seitenfronten der gigantischen Doppelanlage – mit stereometrischen Fensterbändern, hinter denen sich, von außen ununterscheidbar, Proberäume, Garderoben, Büros und Künstlerwohnungen verbargen, sowie schmucklosen, von Kalksteinplatten nüchtern glatt verkleideten Wandflächen glichen sie aufs Haar den neutralen Büro- und Bankcontainern, die zur selben Zeit in der City entstanden; nur der Schriftzug „Kammerspiele“, so monierten Kritiker, lasse an der Rückseite des neuen Theaters erkennen, dass hinter den dortigen dezenten Glastüren nicht eine moderne Anwaltskanzlei, sondern ein intimes Theater auf Besucher warte.
Der Neubau, so erklärte Oberbürgermeister Werner Bockelmann zur Eröffnung im Dezember 1963, sei „das Werk einer Bürgerschaft, die in diesem Haus zu repräsentieren und sichtbar zu machen wünscht, dass nicht nur Geld und Politik das Leben bestimmen.“ Seine Worte sind nicht als Sonntagsrede abzutun – es war den Architekten und Bauherren durchaus ernst mit dem Wunsch, eine Architektur zu schaffen, in der die Macht und der Rang der Kunst sinnfällig werden und dem nackten Funktionalismus der Banken- und Versicherungsbauten ringsum Paroli bieten sollten.
Dem Zeitgeist entsprechend sollte aber die Repräsentation sinnenfreudiger Gegenwelten dem Zauber der Bühne vorbehalten bleiben – ihrer architektonischen Umhüllung waren nur Andeutungen von Fest und Überschwang erlaubt. Folgerichtig beschränkten die Architekten sich auf edle Materialien wie Solnhofener Marmor und verschwenderische Treppenfluchten im Inneren. Damit gerieten die Foyers und Wandelgänge von Oper und Schauspiel trotz Askese zu beeindruckenden, kühl-eleganten Raumfluchten; ein Hauch von Mies van der Rohe strömte durch die Abfolge ihrer Rampen, Pfeiler und Nischen, die das Innere gliederten. In der Oper sorgte überdies die alte Raumschale des einstigen Schauspielhauses, die man aus Sparsamkeitsgründen beibehalten hatte, für erhebende Eindrücke – noch immer schwangen unter ihrer modernen Neutralhülle die Ränge so mitreißend wie zu Zeiten des Jugendstils.
Im neuen Schauspielhaus hatte man mit Anklängen an die amphitheatralischen Schwünge des antiken griechischen Theaters zu einer bestechend großzügigen Synthese aus Einst und Jetzt, antiker und moderner Demokratie gefunden; besonders stolz war der Intendant auf die neuestem Standard entsprechende Bühnentechnik und auf die Bühne selbst, die seinerzeit die breiteste Europas war. Man habe ein Theater „aus heutigem Empfinden und nach heutigen Erfordernissen“ geschaffen, urteilte die bundesdeutsche Presse; die New York Times attestierte: „Frankfurts kulturelles Leben zieht mit dem Berlins gleich.“
Wie überall im damaligen Deutschland half auch in der Theaterdoppelanlage die staatlich verordnete „Kunst am Bau“ den Architekten, über ihren Purismus-Schatten zu springen. So kamen Frankfurts Städtische Bühnen zu jenem Kunstwerk, das nach schwierigen Anfängen inzwischen längst als Signet des Hauses anerkannt, ja geliebt wird: Die goldenen (Messing) Kumuliwolken des ungarischen Künstlers Zoltán Kemény. Pragmatiker akzeptierten die an fast unsichtbaren Stahlseilen von der Decke hängenden Rundgebilde als wirksamen optischen Kniff, der die immense, um nicht zu sagen öde Höhe des Foyers kaschiere; Kunstliebhaber feierten das Wolkengebilde sofort als jenes abstrakte Symbol für die „himmlische“ Freistatt der Kunst, als das Keménys Werk heute geschätzt wird.
Spontane breite Zustimmung fand Marc Chagalls Kolossalgemälde Commedia dell’ Arte, das die Stadt 1959 bei dem Künstler als zentralen Wandschmuck des Foyers in Auftrag gegeben hatte. Das Gemälde ergänzten in den folgenden Jahrzehnten einige Büsten einstiger Größen des Frankfurter und des deutschen Theaters sowie die von Schauspielern und Sängern, die während des Dritten Reichs wegen ihrer jüdischen Herkunft verjagt, in die Emigration getrieben oder ermordet worden waren. So gewann im Lauf der Zeit die bildende Kunst in dem kahlen Neubau ein wenig ihres ursprünglich großen Terrains zurück.
Die Rückkehr der Schmuckform
1963 entsprach die betont sachliche Architektur dem experimentierfreudigen, zuweilen provokativen Stil, den die Intendanten der Oper und des Schauspiels in Frankfurt pflegten. Dasselbe gilt für den zweiten Höhepunkt des Hauses, als zwischen 1972 und 1980 unter der Doppelintendanz von Peter Palitzsch und Hans Neuenfels Frankfurts Schauspiel im Gefolge von 1968 ein Mitbestimmungsmodell einführte. Plötzlich war das schmucklose Äußere des Hauses, waren seine oft bespöttelte Fabrikfassade und seine demonstrativ unpathetischen Innenräume der ideale Rahmen für Experimente, die Schauspieler und Publikum zu Kollektiven zusammenführen sollten, die gemeinsam Kunst erarbeiteten.
Aufschlussreiches Randphänomen: Das Theaterrestaurant, das es nie geschafft hatte, ein wirklicher Nachfolger des einstigen Faust-Restaurants zu werden, zog plötzlich unter dem Namen „Fundus“ Besucherscharen an – nicht zuletzt, weil man den weiten Gastraum mit Requisiten förmlich vollstopfte. Alles, was die Moderne verpönt hatte, feierte triumphale Rückkehr: Plüsch und Schnörkel, Gelsenkirchener Barock und Wiener Cáfehauskringel.
Die Oper, die mit einiger Verspätung sich der Aufbruchstimmung des Schauspiels angeschlossen hatte, stieg zu einem der berühmtesten Häuser Deutschlands, wenn nicht gar Europas auf. Das erleichterte es dem Magistrat, 1986 trotz der enormen Kosten für Frankfurts neues Museumsufer die Sanierung des Zuschauerraums und des Foyers zu bewilligen. Am 30. Oktober 1987 eröffnete die sanierte Oper – das Frankfurter Architektenduo Braun und Voigt hatte, beflügelt von der Bild- und Zitierfreude der damaligen Postmoderne, unter Rückgriff auf die historischen Raumkonturen dem Raum gemäßigt expressionistische Züge verliehen. Perforierte, mit Lichtpunkt-Ketten konturierte und satt gelb eingefärbte Rangbrüstungen, die keilförmig näher zur Bühne gerückt waren, ließen Hans Poelzigs Theaterutopien der 20er-Jahre assoziieren. Ebenso die mit Punktstrahlern ausgestattete weich gestufte Decke, die sich bei Bedarf zum Sternenhimmel wandeln ließ.
„Am 12. November 1987 wurde das Bühnenhaus der Oper der Städtischen Bühnen durch einen Großbrand vernichtet.“ So lapidar liest sich im amtlichen Bericht der Frankfurter Branddirektion die größte Katastrophe, die Frankfurts Theater seit der Bombennacht des Januar 1944 ereilte. Augenzeugen berichten, dass der Brand, gelegt von einem verwirrten Obdachlosen und von einem Ionisationsmelder nachts um 3.19 Uhr gemeldet, den Eisernen Vorhang zum Glühen brachte. Trotzdem blieben dadurch der Zuschauerraum, die Wandelgänge und das Foyer leidlich geschützt. Doch die Bühne und der Bühnenturm waren nahezu vollständig vernichtet.
Alle Betroffenen reagierten schnell und unbürokratisch: Die Oper bezog das unversehrte Schauspiel, dieses verlegte seinen Spielbetrieb in das Bockenheimer Depot, ein renoviertes gründerzeitliches Straßenbahndepot, das sich zuvor schon als eindrucksvolle Spielstätte bewährt hatte.
Braun und Voigt respektive Braun und Schlockermann bauten innerhalb von dreieinhalb Jahren die Oper für insgesamt 170 Millionen Mark wieder auf. Seither zeigt sie einen noch höheren, nun konvex bedachten und mit einer silbrigen Hülle überzogenen Bühnenturm, der vom puren Nutzbau zum monumentalen Bauschmuck geworden ist. An der Rückseite des Gebäudes wurde zudem ein großzügiger Probensaal für das damalige Ballett angefügt. Entworfen nach dem Vorbild der dekonstruktivistischen Glasgebilde, die das umstrittene Architektenteam Coop Himmelb(l)au einige Jahre zuvor auf die Dächer der Wiener Altstadt gesetzt hatte, kragt der Probenraum kühn über den Baukörper hinaus, heute Denkmal eines gemäßigten Frankfurter Dekonstruktivismus – und des Balletts Frankfurt unter Leitung von William Forsythe, das 2004 aufgelöst wurde.
Beim Wiederaufbau musste schließlich doch das gesamte Interieur der Oper erneuert werden. Braun und Voigt nutzten die Gelegenheit zur Verbesserung der Akustik: Nach Entfernen der Putzdecke wurde der darüberliegende Dachraum in das Gesamtvolumen einbezogen. Für den fortan noch großzügiger wirkenden Raum wurde in Zusammenarbeit mit dem japanischen Architekten Toyo ein Beleuchtungskonzept entwickelt, das durch Computersteuerung unterschiedliche Lichtstimmungen erzeugen kann.
Notwendig gewordene zusätzliche Foyerflächen und Probenräume integrierten die Architekten in die freigelegte historische Bausubstanz des einstigen Schauspielhauses; so brachte sich nach fast 50 Jahren „Exil“ der Ursprungsbau optisch in Erinnerung.
Als im April 1991 die Oper den Spielbetrieb wieder aufnahm, startete die Renovierung des vom Hin und Her in Mitleidenschaft gezogenen Schauspielhauses. Die Pläne des belgischen Architektenbüros d’Helft/Verliefden und des hiesigen Teams Heinrici/Geiger lagen bereit. Sie brachen mit konvexen Wanddurchbrüchen, dem Umbau der Empfangstreppe zum doppelseitigen Stufenpodest und zusätzlichen Wandelgängen die vorherige absolute Herrschaft des rechten Winkels und der Sachlichkeit. Seither weist das Schauspiel eine Art „Bühne vor der Bühne“ auf, die dem Publikum Gelegenheit bietet, sich gleichfalls in Szene zu setzen. Dieser neue Zug ins Repräsentative setzt sich fort in der „Panoramabar“ der Schaufront, die inzwischen als Schaufenster des Hauses, seiner Gäste und ausgelassener Premierenfeiern eine feste Institution im Stadtbild geworden ist.
Seit 1992 läuft auch in Schauspiel und Kammerspiel der Spielbetrieb wieder ungestört. Die Bauarbeiten an Frankfurts Städtischen Bühnen aber waren damit nicht beendet. Nach einigen Jahren Pause wurde ein neues Werkstattgebäude notwendig. 2007 fiel der unzureichende alte Gebäudeteil längs der Hofstraße. An gleicher Stelle entstanden nach den Plänen von gmp Architekten neue Dekorationswerkstätten, Räume für die Kostümabteilung sowie Werkstätten für den allgemeinen Bühnenbetrieb, zudem zentrale Umkleiden, Duschen, Lagerflächen und Büros, die im September 2010 bezogen werden konnten. Derweil meldete sich noch einmal das historische Schauspielhaus zu Wort: Mitarbeiter der Städtischen Bühnen wurden 2004 von Willy Praml darauf aufmerksam gemacht, dass sich in der Naxos-Halle, einem weiteren magischen Theater, das vom Industriebau zur Spielstätte aufgestiegen ist, die beiden bronzenen Schwäne, die bis 1961 den Altbau am Main geschmückt hatten, befinden. Sie wurden kurz darauf von einer benachbarten Werbeagentur in deren Entrée installiert. Die Städtischen Bühnen würden sie gerne wieder in ihre Obhut nehmen.
Umbau und kein Ende: Im Zuge des Neubaus der Werkstätten und unter dem Stichwort „Stadteingang Sachsenhausen“ ging gmp auch daran, den Südhof zu überbauen und den Ostflügel der Städtischen Bühnen an der Neuen Mainzer Straße um zwei Geschosse aufzustocken. Auffallendstes Merkmal: Die Blockecke an der Hofstraße wurde durch eine geschlossene Stützenreihe in der Hofstraße geschlossen, die Kammerspiele erhielten einen neuen – ihren dritten – Eingang, und die zuvor hässlich bloßliegenden Hohlblocksteine der mainwärts gerichteten Außenwände wurden nach dem Muster der Seitentrakte mit gefugten Travertinplatten verkleidet.
Zum ersten Mal und obwohl fast ein Dutzend Architekten seit 1961 an der Theaterdoppelanlage tätig gewesen sind, bietet sich gegenwärtig der Riesenbau nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch und einheitlich dar. Die Vollendung kommt zur rechten Zeit, denn künftig wird sich das Theater gegen die glamourösen Attacken der steinbeschichteten weißen Türme und Großkuben des neuen „Riverside Financial Districts“ behaupten müssen. Die Chancen stehen nicht schlecht, denn zumindest gegen den erhebenden „himmlischen“ Glanz der Kumuli von Zoltán Kemény kommt kein Werk der aktuellen Event-Dekorationskunst an. Und im Inneren – das lässt so manchen architektonischen und bildhauerischen Verlust verschmerzen – debattieren wie schon vor 250 Jahren die Zuschauer, ob die auf der Bühne „es nur spielen“.
Dieser Beitrag wurde erstellt für die Publikation „Ein Haus für das Theater. 50 Jahre Städtische Bühnen Frankfurt am Main“, Herausgeber: Städtische Bühnen Frankfurt am Main GmbH, erschienen beim Henschel Verlag in der Seemann Henschel GmbH & Co.KG, Leipzig 2013
Einweihungsrede von 1963
Rede des Intendanten der Städtischen Bühnen Harry Buckwitz anläßlich der Eröffnung des neuen Schauspielhauses in Frankfurt, 14.12.1963
Den lieb ich, der Unmögliche begehrt! Großer Goethe, du läßt es deine Sibylle Manto im Zweiten Teil des Faust sagen, und ich möchte dieses titanische Wort zum Leitspruch dieses Theaters erheben! Mut zum Wagnis! Entschlossen, das Unmöglich Scheinende in den Plan mir einzubeziehen. Lieber ewig unterwegs sein im Flug nach den Sternen, als täglich landen auf den sicheren Plattformen des Konformismus. Der Leistung die Chance geben, eine Tat werden zu können. Vielleicht eine umstrittene, vielleicht eine unübersehbare, immer wieder aber eine eigenwillige Tat.
Diese Bühne ist nur ein Spielgerüst. Aber ein Spielgerüst, auf dem das Spiel zum Gleichnis und unser Leben in die mythischen Zusammenhänge der Schöpfung transponiert wird. Wir leben, also haben wir einen Auftrag. Welchen? Bleibt er uns sichtbar in der Brandung der Alltagsobliegenheiten? Wer behält die Übersicht? Wer erinnert uns, worauf es ankommt, wenn uns die Erfolge blind oder die Niederschläge besinnungslos werden lassen? Die Propheten, also die Dichter! Die Instanz des Gewissens, also das Theater! Es hält Botschaften bereit. Sie, sehr verehrte Freunde dieses Theaters, sollen diese Botschaften beachten, überprüfen, zu Herzen nehmen oder leidenschaftlich ablehnen. Wir, die Stellvertreter des Dichters, werden Ihnen als Provokateure, als Ketzer, als Apostel gegenübertreten. Es werden Worte fallen, die Ihnen die Brust sprengen vor Seligkeit, und solche, die Ihnen das Blut gefrieren machen, vor Schreck.
Wir sind ja nicht aufgerufen, um Ihnen unumstößliche Wahrheiten auszuhändigen, sondern um Sie zu verführen, sich den Wahrheitssuchern anzuschließen. Aber welch musischer Gnade bedürfen wir, um Sie von Zuhörern zu Aufhorchern werden zu lassen! Um Sie nicht nur vom Alltag abzulenken, sondern Sie auf den Tag, auf den Stich tag gerade Ihres Fragengeflechtes hinzulenken. Kairos nannten die Griechen jenen besonderen Augenblick, in dem aus einer geistigen Übereinstimmung, aus einer glühenden Anteilnahme, aus einer schonungslosen Selbstentäußerung jenes blitzende Einverständnis aufleuchtet, das die Menge zur Gemeinde und den Pfahlbürger zum Mitmenschen werden läßt.
Möge sich dieser Augenblick in diesem schönen neuen Haus immer wieder einstellen!
Ich glaube, es ist prädestiniert dafür. Denn es ist ein Haus gedämpften Glanzes. Eine Muschel, die nah am Mund der Bühne liegt und das Wort des Dichters in ihrem Gehäuse weiterrauschen läßt. Eine Mulde, die Sie und Ihren Nachbarn eng umschließt und uns Schauspieler in Ihre Gespanntheit mit einbezieht.
Das Erlebnis Theater erhält hier geheimnisvolle Vorstufen und erlesene Erweiterungen. Hinter der gläsernen Kristallfront öffnet sich ein Querschiff, das in unbegrenzte Perspektiven ausschwingt. In seinen Höhen rollen die Metallelemente unseres grandiosen Zoltan Kemeny, als wären sie vor den Sonnenwagen des Gottes Helios Gespannt. Sie treten nur dort ehrfurchtsvoll zur Seite, wo ein Raum ausgespart ist für das einmalige Werk Marc Chagalls, dass sich wie die seraphische Landschaft der Komödianten Gottes darbietet. Es ist Signum und Herzstück dieser Theaterinsel. Es ist wie ein leuchtendes Vermächtnis, das uns fast schon legendäre Meister anvertraut hat. Und noch ein unübersehbarer, flammender Akzent weist auf die Polyphonie von bildender und darstellender Kunst hin: es ist die kühne, faszinierende Plastik des ungeheuren Henry Moore. „Knife’s edge“ nennt er die stählerne Spirale, die wie eine klingende Metapher im Raum steht.
ln den Annalen unserer Stadt Frankfurt wird man noch in Jahrhunderten nachlesen können, daß die Eröffnung dieses Schauspielhauses ein theaterhistorisches Ereigniswar. Das Ereignishafte dokumentiert sich aber nicht dadurch, daß diese Stadt umeinen Prachtbau bereichert wurde. Es dokumentiert sich vielmehr durch ein unüberhörbares Bekenntnis der Frankfurter Bürgerschaft zu spektakulären Werten, die nicht an der Börse gehandelt, oder in einer Gewinn- und Verlustrechnung festgehalten werden können. Die Frankfurter Bürger haben sich selbst dieses Haus geschenkt, weil das Geistig-Musische die unentbehrliche Ergänzung zu den nüchternen Tagesgeschäften darstellt. Weil das Ingenium des Dichters den besseren Menschen in uns zur Mitsprache ermutigt. Weil der Adel des geformten Wortes auf den Hörer überspringt und ihn das Wunder unserer Sprache, den Zauber eines klar formulierten Gedankens neu erleben läßt.
Ein Ort der Besinnung, eine Insel für literarische Ausflügler, ein Raum für geistige Kosmonauten wurde geplant, gegen tausend Widerstände durchgetrotzt und an diesem denkwürdigen 14. Dezember 1963 eingeweiht. Ein Preislied müßte angestimmt werden für all jene Unbeirrbaren, denen dieses Werk zu verdanken ist. Wir kennen ihre Namen, und sie sollen in jenes Buch der Erinnerung eingetragen werden, das unauslöschlich ist, weil wir es im Herzen bewahren. Wahrscheinlich kann sich keine Stadt der Welt rühmen, daß ihr Oberbürgermeister, ihr Bürgermeister und ihr Kulturdezernent nahezu jede Theaterpremiere besuchen. Wir in Frankfurt können es. Und deshalb fühlen wir Frankfurter Bühnenkünstler uns auch besonders ausgezeichnet, daß ein Werner Bockelmann, ein Rudi Menzer und ein Karl vom Rath unsere verlässlichsten Freunde und gleichzeitig unsere ehrlichsten Kritiker sind. Der Dank dieser Stunde umfaßt aber auch alle Vertreter unseres städtischen Parlamentes, denn sie
waren es ja, die in verantwortungsvollen Entscheidungen diesen Theaterbau zu bejahen hatten; Dank auch den phantasievollen Architekten, den sorgfältigen Technikern und den geschickten Handwerkern und nicht zuletzt Dank jenen unentwegtem Verbündeten der Frankfurter Presse, die zur Popularisierung dieses Baues so viel beigetragen haben.
Nicht Besitz ergreifen wollen wir von diesem Theater, sondern wir wollen es wie eine kostbare Leihgabe in unsere Obhut nehmen. Es wird uns nur so lange anvertraut blieben, als es uns gelingt, das Pandämonium unserer Welt auf diese Bühne zu beschwören.
Zoltan Kemeny – Eine Einführung
Der französische Schriftsteller und Kunstkritiker Michel Ragon (1924 – 2020) befasste sich schon früh intensiv mit Kemenys Werk. Der Katalog, aus dem dieser Einleitungstext stammt, erschien 1960 – kurz bevor Kemeny den Auftrag für die Gestaltung des Foyers der Städtischen Bühnen erhielt.//
Kemeny ist von jeher ein sonderbarer, origineller Künstler und ein Aussenseiter gewesen. Er war mir anlässlich seiner Ausstellung in der Galerie Mai im Jahre 1950 aufgefallen. Diese Ausstellung war bereits merkwürdig durch die Tatsache, dass es sich um die Ausstellung eines Künstlerpaares handelte: Madeleine und Zoltan Kemeny. Am meisten jedoch beeindruckte die Tatsache, dass die beiden parallelen Werke eine Familienähnlichkeit aufwiesen und gleichzeitig grundlegend voneinander verschieden waren. Beide waren von dichterischer Inspiration und hatten Sinn für Suchen ausserhalb der übliche Wege, für unseren Trost für so viele Konformisten. Zoltan Kemeny war damals eigentlich kein Bildhauer. Aber war er ein Maler? Er trug bereits seine grundlegende Originalität zur Schau, die er im Laufe der Jahre noch vertiefen und die aus ihm jenen Künstler machen sollte, der weder Bildhauer noch Maler ist, aber etwas von beiden Techniken und beiden Disziplinen hat. Er war bereits ein Reliefmaler (oder, wenn man will, ein Bildhauer von erhabenen Bildern). Seine Bewunderung für Dubuffet und seine Freundschaft mit ihm führten ihn zu einem „Kunst-im-Rohzustand“-Geist. Und durch diesen Geist, durch diese Kollagen aus damals schmutzigen Materialien springt Kemeny durch den Spiegel.
Durch den Spiegel springen. Ich will damit sagen, dass man sich mit seiner Erziehung, seiner Vergangenheit, seinen Gewohnheiten auf den Weg macht, und wenn man versucht weiterzugehen, so rennt man gegen einen Spiegel, der zu einer Ausgangstür werden kann, wenn einem das Wunder gelingt, durch das Spiegelbild seines eigenen Bildes hindurchzugehen.
Betrachten wir einmal kurz Kemenys Vergangenheit. Wir erkennen dann, dass diese ihn in keiner Weise vorbestimmte, der aussergewöhnliche Künstler zu werden, den wir heute kennen. Vielleicht doch in seiner Kindheit oder als junger Mann. Aber findet der Mann von vierzig Jahren, dem es gelingt, durch den Spiegel zu springen, nicht meistens die vergessenen Tugenden seiner Jugend wieder?
ln einem Bergdorf in Transsylvanien, wo sein Vater Stationsvorsteher in einem ganz kleinen Bahnhof war, wurde Zoltan Kemeny im Jahre 1907 mitten im Lärm der Züge und des alten Eisens geboren. Zehn Jahre später war das Kind Gehilfe eines naiven Schildermalers geworden. Eigentlich hätte er lieber bei einem Porträtisten gearbeitet, aber der verlangte einen so hohen Preis, um einen Lehrling anzunehmen, dass ein Schildermaler ausreichend erschien. Und Zoltan Kemeny lernte wirklich viel bei diesem Dorfmaler, der seine Schilder à Ia Rousseau oder à Ia Vivin malte. Er rieb seine Farben auf Marmor, malte auf Blech, bereitete den Grund der Schilder vor. Als ihn der Meister zum ersten Male ein Motiv zeichnen liess, und zwar Würstchen, glaubte Zoltan Kemeny, dass er „es geschafft“ habe. Er veranstaltete sogar seine erste Ausstellung im Schaufenster seines Lehrherrn, der auf diesen Schüler sehr stolz war.
Aber da der Beruf eines Schildermalers keine grosse Zukunft zu versprechen schien, wurde das Kind mit vierzehn Jahren Tischlerlehrling. Am Tage war er Tischler – abends verwandelte er sich in einen Studenten. Mit siebenzehn Jahren hatte er Lust, Architekt zu werden. Das führte ihn an die Akademie der Künste in Budapest, an der er von seinem achtzehnten bis zu seinem dreiundzwanzigsten Lebensjahr Kunstgewerbe und Architektur und dann Malerei studierte.
An dieser Akademie der Künste, wo sein Lehrer ihm von den französischen Malern sprach, lernte er Frankreich lieben, und im Jahre, das das Ende seiner Studien sah, verliess er Ungarn und ging nach Paris. Er bleibt in Paris, bis ihn der Krieg vertreibt, das heisst von 1930 bis 1943. Aber was er an Malerei sah, enttäuschte ihn. Er kehrte entschlossen zur Architektur zurück, liess nur Zement und Glas gelten und zieht die Nacktheit einer Mauer dem Werke jedes Künstlers vor. Er machte in Paris Schmiedearbeiten und graviertes Glas und lancierte schliesslich mit seiner Frau ein Atelier für Modezeichnungen, das sie beide geradewegs dem Reichtum und dem gesellschaftlichen Erfolg entgegengeführt hätte, wenn der Krieg diese bürgerliche Zukunft nicht zerstört hätte.
Nachdem das Exil diese glänzende Laufbahn unterbrochen hatte, liess sich Kemeny in der Schweiz nieder, wo er als Modezeichner für eine Zeitung in Zürich arbeitete. Zoltan Kemeny könnte niemals César Birotteau in Paris sein. Fern von der künstlerischen Tätigkeit packt ihn die Sehnsucht nach der Malerei. Er fing noch einmal ganz von vorn an, und als er im Jahre 1945 in der Galerie Kleber seine erste Ausstellung in Paris veranstaltete, bestand diese aus naiv-surrealistischen Bildern, die ihm nur wenig Gehör verschafften.
Er schloss sich in Zürich in seine Einsamkeit ein, da sein Broterwerb ihn von den künstlerischen Kreisen fernhielt, wurde ihm vielleicht das Wagnis, alles nochmals aufs Spiels zu setzen, leichter. Zürich ist die Provinz, aber auch die Stadt die Joyce gewählt hat, um dort Ulysses zu schreiben. Zürich ist auch die Stadt, in der 1916 die Dada-Explosion geboren wurde. Zürich war damals mit intellektuellem Dynamit geladen. Die Spiegelgasse, die heute in Nummer 11 einen amerikanischen Kunstkritiker und seine internationale Zeitschrift für zeitgenössische Kunst beherbergt, hatte damals Lenin in Nummer 12 zum Mieter, während in Nummer 1 das Cabaret Voltaire von Hugo Ball – Arp, Sophie Täuber, Tzara, Janco, Hulsenbeck und andere zu seinen Stammgästen zählte.
Seither hat Zürich seine Ruhe wiedergefunden, an seinem See und in den Flanken seiner Berge. Aber wenn ich von dieser übrigens nahen Vergangenheit spreche, so weil ich glaube, dass Zoltan Kemeny, einsam in Zürich, dessen letzten Hauch dieses welken Parfums einzuatmen verstanden hat. ln seinem Werke liegt etwas vom Geiste Joyce’s und Dadas. Er ist ihr würdiger Erbe.
Zoltan Kemeny ist äusserlich ruhig und ordentlich, höflich, liebenswürdig. Der Gedanke, dass er nichts zu sagen habe in seiner Konversation und in seinem Leben keine Anekdoten für Journalisten zu finden sind, scheint ihm Sorgen zu machen. Da Kemenys erste Reliefs aus Lumpen, Leim und Sand jedoch schlaffe Gestalten, Venusse à Ia gidouille Ubu’s sind – muss man sich fragen, welch Trieb dem Modezeichner diese „Scheusslichkeiten“ eingegeben hat. Dieser Mann, der so normal scheint, geht heute hin und kauft sich Wagenkühler, und zum grössten Verblüffung des Fabrikanten lässt er sie in vier Teile zersägen, und dann zerfetzt und entstellt er sie.
Was für Werkzeuge hat dieser Maler? Betreten wir sein Atelier am Ende eines Gartens. Wir stolpern über Sauerstoffflaschen, eine Bohrmaschine, eine elektrische Säge, Material zum Schweissen, Säureflaschen, Farbtöpfe, Kupferbohrer, Aluminiumspäne, Blechplatten – das typische Atelier eines organisierten Bastlers, eines Sonntagsmechanikers.
Für Kemeny ist die Epoche der erstickenden Einsamkeit beendet. Zweifellos bedauert er das bisweilen. Aber er hat weder ohne Mühe noch ohne Opfer durch den Spiegel springen können. Vor der ersten Ausstellung seiner Metall-Reliefs in Paris bei Paul Facchetti im Mai 1955 bleibt sein Werk lange unbekannt. Er hatte sogar im Februar-März 1949 eine Ausstellung von Kleinwerken in ausgeschnittenem und getriebenem Metall über das Thema Der Gärtner in seiner Wohnung in Zürich veranstalten müssen. Aber es war trotzdem eine entscheidende Ausstellung, denn sie enthält bereits den ganzen Kemeny, sie erklärt, woher er kommt und wohin er gehen wird.
Warum dieses Thema vom Gärtner? Wegen der Schlussfolgerung im berühmten Märchen von Voltaire: „Gut gesagt“, antwortete Candide, „aber wir müssen unseren Garten pflegen“. Wie Candide war Kemeny damals durch eine Reihe von Missgeschicken gegangen. Diese in seiner Wohnung ein paar seltenen Besuchern gezeigten Werke waren das Ergebnis von drei Jahren Gartenpflege, die phantastische Ernte aus seinem geheimen Garten. Über die Primitiven, die Naiven, die Irren kam er zu seinem Schildermaler zurück. Sein Gärtner war eine Persönlichkeit, eine Art „Monsieur Plume“. Der Gärtner von seinen Freunden gesehen. Der Eisenschmied zeichnete ihn mit der Lötlampe auf Blech. Der Goldschmied machte sein Bildnis, indem er dem Kupfer Perlmutter beimischte. Der Erdarbeiterformte eine Statue aus Zement, Asphalt und Perlen. Der Maurer bearbeitete Ziegel. Der Glasarbeiter machte Mosaiken aus Glas. Der Tischler schnitzte Holz. Der Gärtner modellierte die Erde. Und der Steinmetz bearbeitete natürlich den Stein. Der Kurzwarenhändler bediente sich der Knöpfe, der Gipser des Gipses, der Klempner des Bleis. Sich so vieler Mittel zu bedienen, um sich zu malen, war für Kemeny wie die Katze, die sich die Nägel poliert. Eine Art, sich in Stimmung zu bringen. Als ob es gar nichts wäre, versuchte er so, sich der klassischen Materialien zu entledigen, die ihm für das Werk, das er unternehmen wollte, unwirksam erschienen. Gips, Erde, Kupfer, Zement, Eisendraht, Knöpfe, Blei, Erbsen, Raphia, Lumpen, Perlmutter, Holz – er stellt bereits eine ganze Liste von Materialien auf, mit denen er experimentiert. Er zögert noch bezüglich einer seinen Werken eigenen Terminologie. Er bezeichnet sie als „Reliefs, Statuen, Malereien“. Ein Jahr später kommt er nach Paris und stellt der meisten und einige jüngere Werke bei Mai aus; darunter befinden sich Persönlichkeiten vom Krautermann mit trockenen Gräsern und Korn, und Die Familie des Gärtners vom Kurzwarenhändler mit Teer, Knöpfen und Croquets.
Im heutigen Kemeny ist etwas vom Schildermaler, vom Tischler, vom Eisenschmied, vom Graveur und vom Architekten. Er besitzt, was so vielen Künstlern fehlt: eine menschliche Erfahrung ausserhalb der strikten Welt der Kunst.
Bevor Kemeny an die Schaffung eines seiner Reliefs geht, macht er viele kleine Zeichnungen. Dann überträgt er sie auf ein Blatt, das die Grösse des geplanten Bildes hat. Es handelt sich um einen genauen Plan mit Koordinaten. Vor Ausführung mit den Materialien, prüft er in seinen Metallkatalogen die zu machende Bestellung, definiert er Längen und Formen. Denn heute arbeitet Kemeny nicht mehr mit Schrot und Abfällen, sondern mit neuen, für seine Zwecke zugeschnittenen Materialien Und wäre es nur wegen des Kaufpreises – der Stoff seiner Bilder verlangt Voraussicht und keine allzu grosse Verschwendung. Aber es liegt auf der Hand, dass er sich im Laufe der Montage zum Improvisieren hinreissen lässt, denn das Relief verlangt andere Konzeptionen als die flache Zeichnung Diese Montage sieht die vorherige Ausführung von geschweissten Einzelteilen vor, die vor ihrer Befestigung auf ihrer Unterlage im Atelier sich kurios anhäufen und jeden freien Platz einnehmen. Das Metall wird erhitzt, um gebogen und gewunden zu werden, dann wird es gefärbt. Die meisten Reliefs von Kemeny wiegen, wenn sie fertig sind, zwischen dreissig und achtzig Kilo. Ihre Farbe geht von Grün zu Blau, von Grau zu Rohkupfergelb, von Rot zu Schwarz. Auf der Rückseite der Bilder zeugen hunderte von Schraubenmuttern von der Kompliziertheit und der Genauigkeit der Ausführung. Die Verwirklichung eines Reliefs ist von den ersten Skizzen bis zum Anziehen der letzten Schraube, nach Aufstellung des Planes, der Suche nach den Stoffen, der Herstellung der Einzelteile und deren Zusammenstellung auf der Unterlage aus Holz, eine sehr lange Arbeit, wie man sich denken kann. Daher verfertigt Zoltan Kemeny, obwohl er augenblicklich einen Gehilfen verwendet, nicht mehr als fünfzehn bis zwanzig Reliefs im Jahr. Diese „Bilder“ sind von erstaunlicher Mannigfaltigkeit. Einige erinnern an futuristische Architekturen. Flach auf den Bo-den gelegt werden sie zu märchenhaften Pfahlstädten auf verschiedenen Niveaus – zu von den Azteken verbesserten und von Marinetti korrigierten New Yorks.
Andere sind ganz aus Kupferzeichen hergestellt. Ich kenne eines, das er Hit-Hite nennt und das aus etwa hundert H’s besteht. Ein anderes besteht nur aus Nieten (es gibt viele Bilder von Kemeny über das Thema der Nieten). Ich sehe auch eine Serie von in Streifen geschnittenen Kühlern. Eine sonderbare Metamorphose: diese Kühler, diese Kühlerstücke werden, wenn sie zusammengesetzt sind, zu Waben eines Bienenkorbs. ln seiner gegenwärtigen Periode erliegt Kemeny überhaupt dem Morphologischen. Er nennt das seinen „Naturalismus“. Denn dieser Bildhauer gibt sich für einen Maler aus, und dieser Künstler, der unter die „Abstrakten“ eingereiht ist, bezeichnet sich als Naturalisten. Es ist nicht seine einzige Zweideutigkeit. Jedenfalls nehmen viele seiner Reliefs aus den Jahren 1958-1959 eine morphologische Haltung an: Waben, Zehen, Pilze, Brustkasten, Kräuter. Aber in der gleichen Periode verfolgt ihn das mechanische Bild (Broyeuse de Peur). Gewisse auf einer Tonunterlage festgemachte Metalle sind eher auf den Boden zu stellende Reliefs als an die Wand zu hängende Bilder. Aber es trifft zu, dass Kemenys Reliefs manchmal mehr Bild als Skulptur sind, und manchmal ist es umgekehrt. Einige sind wirklich Skulptur, und Kemeny denkt bisweilen an die Möglichkeiten seiner Kunst im eigentlichen Bereich der Bildhauerei. Aber noch bleibt er an der Schwelle stehen und träumt, übrigens in der Hauptsache von Bildern, die sich bewegen. Aber die sich bewegen, ohne sich zu wiederholen, ohne mechanisches Uhrwerk, nur aus einem Eigenleben heraus. Zum Beispiel mittels der Farbe. Gewisse morphologische Formen und der ewige Gedanke an Bewegung führen ihn bisweilen zu einem grossen Barock. Er leugnet das nicht. Er hätte gern Musikinstrumente gebaut, für die er komponieren und die er selbst spielen würde. Er denkt an die Eskimos, die Musikinstrumente aus einem menschlichen Schulterblatt herstellten und ihnen herzzerreissende Töne entlockten. Je stärker die Reliefs heraustreten, desto mehr nimmt Kemenys Kunst einen wahrhaft monumentalen Charakter an. Man stellt sich vor, welche Hilfe er der zeitgenössischen Architektur sein könnte. Welcher Architekt wird verstehen, dass Kemeny im Begriff ist, die Bas-Reliefs eines aus Stahl und Glas gebauten Parthenons unserer Zeit zu schaffen?
Kemenys Reliefs bilden eine sonderbare Symphonie aus Falzen, Höckern, Schluchten, Sternenregen in T-Form, Tränen aus roten Nägeln, rasiermesserscharfen Kupferwellen, halluzinierten Geometrien, Karten-Sammlungen unbekannter Planeten, beängstigenden Mineralisationen. ln seinem Buch Von den Bas-Reliefs zu den Heiligen Grotten hat Andre Malraux vom Doppelsinn der Reliefs gesprochen, halbwegs zwischen der Skulptur und der Malerei. Zoltan Kemeny hat die Tradition dieser doppelsinnigen Kunst wiederaufgenommen, aber ganz anders als Arp oder Moholy-Nagy.
Seine „Bilder“ (er nennt seine Reliefs niemals anders) lösen sich in beunruhigenden Erscheinungen aus dem Rahmen. Sie sind lauter Mauervorsprünge. Man sieht sie aufgehen, mit ihren schneidenden Gräten ihre wollüstigen Balkons und Vorsprünge überragen. Sie haben helle Stellen und Rundungen, sie gehaben sich wie Hebearme in einem Zahnwerk. Andere beginnen zu wachsen, zu reifen, wie Bäume Ringe an-zusetzen. Einige sind aus den Fugen geratene Steinvorsprünge. Andere die von Mallarme geworfenen Würfel. Er gibt seinen Reliefs Titel, und diese Titel sind an sich kleine poetische Perlen, die vor dem Werk ohne Gesicht nachdenklich stimmen. Er nennt ein mit Eisenspänen bepudertes Relief Tröpfchen-Unendlichkeit. Aber es gibt noch merkwürdigere: Freundschafts-Sucher, Gedankenhaut, Kleiner Abend am Morgen, Kleiner Tag am Abend, Vorort der Engel, Oktogon-Töne, Moralische Batterie, Himmleskräuter, Nervöse Blume.
Dieses Werk ist das Werk eines Dichters und eines Plastikers zugleich. Zwei Probleme beherrsch en es die übrjgens die Grundlage der Suche der seit etwa 1955 zu Tage getretenen Künstlerwelle sind: der Raum und die Strukturen. Dieser Raum wird bei Kemeny durch eine äusserst bewegliche Oberfläche mit unvorhergesehenen Rhythmen suggeriert. Es ist kein statischer Raum wie in der klassischen Kunst; sondern ein dynamischer Raum. Und die Strukturen haben Kemeny, seitdem er zur Malerei zurück gekehrt ist, nicht aufgehört zu beunruhigen. Denn er ist zu seinen Reliefs durch die Entwicklung eines Malers und nicht die eines Bildhauers gelangt. Zunächst hat er seine Reliefs mit Öl gemalt, dann mit Sand, Leim, Lumpen. Aber die Zerbrechlichkeit seiner Werke, ihr heikler Charakter haben ihn dazu gebracht, Metall zu verwenden. Zunächst Eisen und Kupfer. Heute Aluminium oder Aluminium und Kupfer. Jetzt beginnt er mit plastischem Material, das er bemalt.
Zoltan Kemeny ist ein geschickter Handwerker und gleichzeitig ein visionärer Künstler und denkt an Elektronik und Kybernetik, an alles, was die Entwicklung der Technik der Entwicklung der Kunst zu bringen vermag. Er bezeichnet sich als Naturalisten, etwa wie Jean-Jacques Rousseau sich als Naturalisten bezeichnete. Zur Zeit des Gärtners botanisierte Kemeny in den Feldern, heute sucht er in der Wissenschaft nach Beute. Geologie, Biologie und Metallographie begeistern ihn. Er spricht von Metallen wie von Lebewesen. Das im Mikroskop beobachtete Leben des Metalls entzückt ihn. Er sagt: „Das Eisen hat Herz, hat Nerven.“ Das Atmungssystem einer Pflanze kann dasselbe sein wie das Molekularsystem des Stahls. Es bestehen sonderbare Ähnlichkeiten zwischen einem Topf voller Mikroben und Metallmolekülen. Diese Analogien, dieser Doppelsinn interessieren ihn leidenschaftlich. Deswegen gelingt es ihm auch, uns durch den Doppelsinn seiner Kunst, die keiner anderen ähnlich ist, leidenschaftlich zu interessieren. Er findet, das XX. Jahrhundert sei das „gewaltigste aller Jahrhunderte“. Kemenys Lötlampe lässt genaue und geduldige Bilder erstehen. Man kann sagen, er habe mit der Schweisslampe gemalt wie andere mit dem Pinsel oder mit dem Messer. Es gibt nämlich kein Gesetz. Noch andere malen mit ihrer Hand, ihren Fingern, dem Pinselstiel, einem Besen oder mit den Utensilien eines Anstreichers oder auf andere ebenso ungewohnte Art. Kemeny malt mit der Warme. Das Instrument, das das Werk ausführt, bedingt häufig dessen Natur. Welcher Literaturkritiker wird auf den Gedanken kommen, ein Werk über den Einfluss der Schreibmaschine auf die Zeitgenössische Literatur zu schreiben? Man schreibt auf der Schreibmaschine nicht genauso wie mit einer Gänsefeder. Man kann auch nicht dasselbe mit einem Messer zum Auftragen der Farbe und einem chinesischen Pinsel ausdrücken. Auch nicht mit Kupferspänen und Ultramarinsaft. Kemenys Werk (und hier kommt wieder der ins Funktionelle verliebte Architekt zum Durchbruch) ist von den Materialien und den Werkzeugen, die er gebraucht hat, bedingt. Aber das Werk überwindet diese Stoffe, es beherrscht sie, es verpflanzt sie und geht durch das, was die Reliefs an „Seele“ enthalten, über sie hinaus (und hier trennt sich das Werk noch schärfer von den Nachkommen Moholy-Nagy’s und der Neo-Piastiker) Eine Austeilung von Kemeny ist voller Seelen. Voller packender, besitzergreifender, rührender Poesie. Man denkt an den Satz von Jean Cocteau: „Wissen Sie, mein Picasso – seit heute Morgen spricht er.“ Die Reliefs (aber es ist mir so unangenehm, diese Terminologie auf die „Dinge“, auf Kemenys Schöpfungen anzuwenden, dass wir lieber „die Kemenys“ sagen wollen) – bei denen ist man auch darauf gefasst, dass sie zu schreien, zu zwitschern, Blähungen loszulassen beginnen – was weiss ich! Jedenfalls sehen sie uns mit allen ihren Augen an. Sie beobachten uns. Wir sind plötzlich nicht mehr Betrachter, sondern werden betrachtet. Wie im Zoo vor dem Affenkäfig. Und wir werden verwirrt. Und diese Androiden ohne Gesicht werden nur noch beunruhigender. Wer ist lebendiger – sie oder wir? Bald gibt man dem Gefühl des Schwindels nach. Ist grosse Kunst denn nicht immer Zauberei? Und sucht der Liebhaber, der an den Wänden der Museen und Gallerien entlang schleicht, etwas anderes als den Vorzug, sich verhexen zu lassen ? …
Zoltan Kemeny / Einleitung von Michel Ragon. [Ins Deutsche übersetzt von Hans Jacob]
Editions du Griffon, Neuchâtel-Suisse, 1960.
Kemenys sculptures-peintures
Der Schweizer Kurator und langjährige Leiter des Kunstmuseums Winterthur, Dieter Schwarz, schrieb für den Katalog der Retrospektive zu Zoltan Kemenys Werk am Centre Pompidou Paris 2004 folgenden Essay, der hier erstmals auf Deutsch erscheint.//
Es ist vielleicht kein Zufall, dass eine neue Annäherung an Zoltan Kemeny über die in den Jahren seines Ruhmes vernachlässigten Arbeiten verläuft, nämlich über das malerische Frühwerk1 und über die Zeichnungen. Die Malereien und die Relief-Collages aus den vierziger und den frühen fünfziger Jahren wurden zwar zum Zeitpunkt ihrer Entstehung verschiedentlich ausgestellt, doch nachdem Kemeny mit seinen Metallreliefs bekannt wurde, schenkte man ihnen keine weitere Beachtung mehr; auch von Seiten des Künstlers ist kein Versuch auszumachen, diese Werke in den späten fünfziger und in den sechziger Jahren weiterhin auszustellen.2 Die Zeichnungen wiederum galten offenbar als reine Vorarbeiten für die Reliefs und kaum als Werke, die für sich ein Interesse beanspruchen konnten. Selbst in den grossen Retrospektiven, die kurz nach Kemenys Tod stattfanden, wurde ihnen kein Platz eingeräumt,3 und erst in den letzten Jahren fanden einzelne kleinere Ausstellungen statt, die sich ganz diesem Bereich seines Werks widmeten.4 Es bleibt dahingestellt, ob dabei allgemeine Vorbehalte gegenüber “Bildhauerzeichnungen” mitspielten oder ob Kemeny selbst so zurückhaltend mit den Zeichnungen umging. Gewisse Überlegungen, die sich im Rückblick machen lassen und die im folgenden dargelegt werden, lassen sogar den Schluss zu, dass Kemeny die Präsentation der Reliefs absichtlich von den Zeichnungen trennte, ja dass er es eher vermied, den Reliefs Unterlagen zu ihrer Entstehung mitzugeben. Gerade an diesem “verdrängten” Material lassen sich jedoch Beobachtungen machen, die Kemenys Arbeitsweise in einem neuen Licht zeigen und die seinem Werk und seiner Position innerhalb der Nachkriegskunst eine andere Bedeutung geben.
Wurden die frühen Gemälde in der bisherigen Rezeption stets getrennt von den Metallreliefs betrachtet, so sollen die folgenden Betrachtungen gerade den engen Zusammenhang dieser Werkgruppen dokumentieren, wie er sich schon der ersten, äusserlichen Beobachtung darstellt. Kemenys Werk blieb in gewissem Sinn immer bildnerisch und wurde nie wirklich Skulptur, der Künstler betrachtete es ganz eigentlich als gattungsüberschreitend:“Aujourd’hui il n’y a pas de frontière entre les deux et ainsi mes travaux sont des ‘Sculptures-Peintures’.”5 Die Metallreliefs sind erweiterte Bilder und nicht plastisch konzipierte, räumlich definierte Werke. In der Übersetzung von bildnerischem Geschehen ins Dreidimensionale, schaffen sie nämlich nicht Raum, sondern sie verleihen bloss den dargestellten räumlichen Effekten Körper. Als Beispiel mag hier das Relief Fort âme6 dienen: die scharnierartig nach vorn oder hinten gekippten vertikalen Holzelemente nehmen ganz eigentlich das illusionistische Spiel mit dem Umschlagen von konvexer in konkave Wirkung auf, die in der kubistischen Malerei besonders von Juan Gris eingesetzt wurde (Abb. ..). In den Reliefs wird die Malerei in technoider oder romantisierender Weise verkleidet und ihre dramatische Wirkung mittels plastischer Elemente gesteigert, die über die dargestellte Räumlichkeit des an sich flächigen Bildes hinausgehen. In dieser Hinsicht stehen sie den Ausbildungen des Materialbildes nahe, in denen Farbe mit Sand, Gips und anderen Materialien vermengt wird. Maler wie Fautrier oder Bogart, später auch Tàpies, griffen auf die im kubistischen papier collé entwickelte taktile Differenzierung der Bildoberfläche, aber auch auf die opaken, antikompositionellen Bildgründe von Miró oder Masson zurück, um aus diesen Verfahren schliesslich erneut zu in sich geschlossenen Kompositionen zu gelangen, das heisst die kubistische und surrealistische Kritik am malerischen Illusionismus in einen neuen, vom Material unterstützten Illusionismus zu übertragen.
Sowohl die Malereien wie die Reliefs gehen auf Zeichnungen zurück, die Kemeny aufgrund verschiedenartiger Vorlagen angefertigt hatte. Die frühen Skizzenbücher, die erst vor kurzem zum Vorschein kamen,7 veranschaulichen deutlicher als jedes andere bisher zugängliche Dokument seine Arbeitsweise. Man muss hier daran erinnern, dass sowohl Zoltan wie Madeleine Kemeny ihr Leben während vieler Jahre mit professioneller Zeichenarbeit verdienten. Madeleine Kemeny, die seit Anfang der dreissiger Jahre als Malerin in Paris lebte, begann hier als Modezeichnerin zu arbeiten und setzte sich in diesem Metier auch durch. Als sie wenig später Zoltan Kemeny kennenlernte, führte sie ihn in die Technik ein, mit der sie beide so erfolgreich waren, dass sie sich 1942 dank professioneller Kontakte in der Schweiz niederlassen und hier arbeiten konnten. Kemeny fand bald eine feste Arbeit bei der Modezeitschrift Annabelle, wo er bis Ende der fünfziger Jahre als Gestalter und Berater tätig blieb.8 Das Skizzieren von beobachteten Besonderheiten, das Festhalten der wesentlichen Züge eines Modells und die sorgfältige Ausarbeitung bis zur Druckvorlage war den beiden geläufig; Madeleine Kemeny erinnerte sich an ihre Form der Arbeitsteilung, dass Kemeny jeweils die Figurinen zeichnete und sie dann die präzise Umsetzung besorgte.9
Es mögen Recherchen beruflicher Art gewesen sein, die Kemeny schon in Paris und später in Zürich in die Bibliotheken führten, wo er einschlägige Literatur durchsah. Die Literatur, die Kemeny konsultierte, bestand hauptsächlich aus Monographien zur Volkskunst, zu kunstgewerblichen Arbeiten aus den verschiedenen Weltkulturen. Es interessierten ihn mittelalterliche Buchmalerei ebenso wie asiatische Miniaturen und Ornamente, insbesondere aber die Gestaltungsmittel der Textilkunst, von nordischen Bildteppichen bis zu alten italienischen und französischen Spitzentechniken; dabei ging Kemeny äusserst systematisch vor und untersuchte diese Themen anhand von zahlreichen Monographien und Zeitschriftenartikeln. Bei der Fülle von Titeln aus den Bereichen der Volkskunst und der angewandten Kunst fällt das Fehlen von Publikationen zur bildenden Kunst im engeren Sinne besonders auf; so liessen sich bei der Durchsicht von Kemenys Titellisten nur gerade Monographien über Paul Klee und Henri Matisse und ein Werk über neuere französische Malerei ausmachen.10 Offensichtlich bevorzugte Kemeny für seine Recherchen die Bibliothek der Kunstgewerbeschule Zürich,11 doch er arbeitete auch in der Zürcher Zentralbibliothek und möglicherweise in anderen Bibliotheken.12 Textliche Exzerpte finden sich in seinen Heften keine; dagegen füllte Kemeny die Seiten mit Bildnotizen, denen er oft die entsprechende Buchsignatur zuordnete, so dass sie sich teilweise zurückverfolgen lassen. Meist geben die Skizzen die Konturen der ausgewählten Figuren oder Figurengruppen wieder; manchmal sind Binnenflächen mit Farbangaben beschriftet, als ob es um eine möglichst genaue Umsetzung der Vorlagen gehen sollte. Es scheint, dass Kemeny seine Skizzen direkt mit Bleistift auf die Leinwand übertrug und anschliessend farbig ausfüllte; jedenfalls sind keine weiteren Zeichnungen erhalten, die auf eine dazwischenliegende Verarbeitung schliessen lassen würden.
Unter den Bildern der Winterthurer Sammlung lässt sich dieses Vorgehen besonders deutlich an Dames et enfants13 ablesen; die Identifikation der Vorlage macht anschaulich, dass die Wahl der Wiedergabetechnik nicht einer beliebigen malerischen Idee folgte, sondern dass Kemeny mit den breit laufenden Farbbahnen den Effekt der Stickerei, die er als Vorlage ausgewählt hatte, zu imitieren versuchte. Allerdings konnte ein zeitgenössischer Betrachter diesen Herstellungsprozess nicht nachvollziehen; vielmehr stand er vor einer pseudoprimitivistischen Darstellung, die nur für sich selber zu sprechen schien, da sie einen stilistischen Zusammenhang mit den übrigen Bildern Kemenys fraglich erscheinen liess. Die sculptures-peintures bilden nämlich nicht einen homogenen Korpus, indem sie eine bestimmte Formensprache entwickeln, sondern sie übersetzen Bildvorlagen ihren Voraussetzungen entsprechend in Malerei. Die eklektische Auswahl der Vorlagen ist programmatisch, denn die Eigenheiten der kulturellen Artefakte, die Kemeny verwendete, wurden nur insoweit übernommen, als sie seine technische Virtuosität herausforderten. Dass es ihm dabei an Raffinesse nicht mangelte, erweist die Analyse der frühen Bilder:14 nach dem Verwischen der Spuren, die auf die Vorlage verweisen, scheint ein zweiter Prozess der Entstellung in Gang zu kommen. Die Malerei imitiert den Effekt der kunstgewerblichen Technik, beispielsweise der Spitzenstickerei, und lenkt gleichzeitig davon ab, indem sie ihre Quelle nicht preisgibt. Im selben Moment, da sie sich als Malerei in Szene setzt, verweist sie aber auf ihre Vorlage, denn sie ist weder, was sie darstellt, noch was sie zu sein vorgibt, weder naive Schilderung noch spontane Formulierung. Sie arbeitet im Gegenteil an einem Prozess der Distanzierung, der in einem der spärlichen schriftlichen Notate Kemenys ironisch artikuliert wird:“Weshalb nicht die Natur malen? Aber ja, ich male meine Natur. Alle Maler malen, um zu zeigen, wie man nicht malen darf.”15 Diese ironisch gebrochene Naturmetaphorik stand möglicherweise auch den zahlreichen Reliefs des Zyklus Le jardinier vu par ses amis16 Pate. Die Figur des Gärtners und die Pflege des Gartens liessen sich als Reflexion des Künstlers über den Umgang mit der von ihm kultivierten Bilderwelt, des von ihm recherchierten, kulturellen Bilderfundus als seines Gartens lesen.
Wenn Kemeny die Malerei als unablässiges Überschreiten gegebener Werte und Normen beschreibt, so könnte man ihn in dieser historischen Situation leicht als einen Vertreter der neo-primitivistischen Tendenzen sehen, die unmittelbar nach dem Krieg in der europäischen Malerei auftraten. In einer anderen kurzen Aufzeichnung schrieb er zudem:“Die europäische Kunst wird wie die Negerkunst, die chinesische Kunst, die Hindukunst usf. werden.”17 Es liessen sich dafür noch weitere Argumente finden: nach dem Krieg machten Madeleine und Zoltan Kemeny die Bekanntschaft Jean Dubuffets, der Madeleines Bilder 1948 im Foyer de l’Art brut ausstellte. Im Jahr darauf nahmen Madeleine und Zoltan Kemeny an der internationalen Cobra-Ausstellung im Amsterdamer Stedelijk Museum teil, womit sie ihre Fähigkeit bewiesen, über die Isolation der kriegsbedingt provinziellen schweizerischen Kunstwelt hinauszugelangen und mit Vertretern der internationalen Avantgarde in Kontakt zu treten.18 Doch diese Annäherung scheint Episode geblieben zu sein: weder beteiligte sich Kemeny an einer der programmatischen Publikationen der Epoche, noch scheint er sich überhaupt mit einer Gruppe oder einem Programm identifiziert zu haben. “Ich zeige, wie jedermann Malerei betreiben kann”,19 hielt er in einer anderen Notiz fest und zielte damit weder auf die malerische Kompetenz seiner Zeitgenossen noch diejenige des akulturellen Reservoirs der art brut, sondern auf die Bilderproduktion im allgemeinen. Kemenys Verfahren schliesst ein und nicht aus, und es verweigert sich den vereinfachenden Modellen, die von den genannten Künstlern nach dem Krieg als Programm einer “anderen” Kunst ins Feld geführt wurden. Wenn die art brut damit arbeitete, dass sie den Gegenpart des kulturell Tradierten für sich beanspruchte und damit einem simplen Dualismus verfiel, der in gewisser Weise die Struktur von Bretons Surrealismus reproduzierte, so akzeptierte Kemeny bildnerisches Material verschiedener – hoher oder niedriger – Herkunft ohne Unterschiede. Sein Nachmalen, das sich immer auf eine bestimmte Vorlage bezieht und das sich somit als zitierende oder imitierende Tätigkeit versteht, entzog sich ebenfalls der Hypostasierung einer ursprünglichen Kreativität, wie sie die Cobra-Künstler verschiedentlich formulierten.20 Wie hätte er diesen Weg auch einschlagen können, war doch seine Arbeit von einem anderen Phänomen affiziert, ob er sich nun bewusst darauf bezog oder, was viel wahrscheinlicher ist, nur unbewusst: es ist das Phantom des Ready-Made, das hinter Kemenys Suche im Bilderfundus lauert und das ihn auch während der Periode der Reliefs nie verlässt; das Ready- Made, das selbst dem Neo-Primitivismus und jeder anderen auf das Ursprüngliche zielenden Kunstpraktik als stummer Begleiter beiwohnt, geht es doch stets um die Wahl eines bereits vorgegebenen, noch nicht ästhetisierten Objekts.
Kemenys Arbeit führte nicht direkt von der Negation kultureller Werte in den Primitivismus als eine Möglichkeit, sich scheinbar ausserhalb der etablierten Kunstgeschichte zu bewegen; sie führte vielmehr von dieser einfachen Negation in eine fortwährende Negation, in die Ablehnung jeder fixierten Haltung. Er erreichte dies im Gewand humoristischer virtuoser Bilder und mit den Mitteln des handwerklich versierten graphischen Gestalters, wie sie in den ornamentalen Wiederholungen und Mustern sichtbar werden, mit denen die Bildfläche in den Malereien belegt ist. Als Kemeny 1964 kurz vor seinem Tod von der Verwandtschaft seiner Arbeit mit der ungarischen Volkskunst sprach, erwähnte er ihre strukturelle Analogie:“Ich bleibe ewig unter dem Einfluss der ungarischen Volksmusik. Ich hatte damals denselben Ehrgeiz in der Formulierung des Bildes (écriture du tableau) wie Béla Bartók beim Schreiben der Musik.”21 Es ist die “écriture du tableau” und nicht die Bildlichkeit an sich, die ihn beschäftigte, und das heisst die Art der Transformation einer gegebenen Vorlage im Hinblick auf das Hier und Jetzt, den Moment des Tätigseins:“Weder die Vergangenheit noch die Zukunft interessieren mich. Nur die Gegenwart. Heute möchte ich etwas verwirklichen, was ‘das Heute’ ausdrückt.”22 Wenn sich dieser Gedanke der Präsenz der Malerei oder der künstlerischen Arbeit überhaupt erfüllt hat, so vielleicht gerade in der brüsken Abfolge von Ruhm und Vergessen, der Aufmerksamkeit, die Kemeny begleitete und sich dann von ihm abwandte.
Ende der vierziger Jahre lässt sich in Kemenys Lektüre eine Veränderung feststellen: an die Stelle der kunstgewerblichen Literatur treten Monographien und Zeitschriften zur Mineralogie, zur Botanik, zur Optik, zu physikalischen oder anderen naturwissenschaftlichen Themen, und von der Kunstgewerbeschule wechselt er in die Bibliothek der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Doch nach demselben Vorgehen wie bei den Malereien kopierte Kemeny in seinen Skizzenbüchern Bilder, die ihm verwertbar erschienen, und die entsprechenden Literaturangaben. Diese Zeichnungen wurden im Verlauf des kommenden Jahrzehnts in Reliefs übertragen. Der Übergang von den Malereien zu den Reliefs ist also kein Bruch, sondern bloss eine Verlagerung des Bildmaterials, mit dem Kemeny arbeitete. Daraus lässt sich auch erklären, dass die äusseren Begrenzungen der Reliefs nicht aus den Eigenschaften des jeweils gewählten Materials abgeleitet sind. Vielmehr folgen sie den willkürlichen Begrenzungen, die das photographische oder mikroskopische Bild vorgab. Noch deutlicher wird jedoch hier, dass Kemeny bei der Planung der Reliefs ebenso vorging wie als Illustrator von Zeitschriften; ihm war das Arbeiten mit Transparentpapieren geläufig, die auf dem Leuchttisch kopiert und variiert werden konnten.23 Die ersten Skizzen hatten kleines Format; nach verschiedenen Überarbeitungen wurden die stets auf Transparentpapier ausgeführten Zeichnungen auf grössere Formate übertragen, bis hin zur endgültigen Vorzeichnung im Format 1:1. Aufgrund dieser letzten Zeichnung suchte Kemeny passende Metallformen oder liess diese eigens herstellen liess, um sie dann mit dem Schweissgerät auf der Unterlage zu montieren. Dabei folgte die Gestaltung der Reliefs präzise den Zeichnungen, besonders in den Details, die Kemeny notiert hatte; ebenso wie die sculptures-peintures ging auch dieser Typus von plastischen Bildern aus einer langwierigen Imitations- und Transformationsarbeit hervor. Wurde in der Malerei ein kleinformatiges Bildelement, eine einzelne Figur isoliert und in der Übertragung vergrössert, so entstanden mit den Metallreliefs Bilder nach manipulierten Vorlagen, die so, wie sie nun erschienen, nie existiert hatten.
Kemenys Zeichnungen aus den fünfziger Jahren ähneln in erstaunlicher Weise den abstrakten, postkubistischen Kompositionen, wie wir sie beispielsweise bei Nicolas de Staël oder Jean Bazaine finden, indem meist einzelne Elemente wie Linienverläufe, Schraffuren, Strichbündel und gezeichnete Formen wiederholt werden. Linien und Formen werden gestaffelt und erzeugen Strukturen, und es lässt sich bis in die einzelne Linie hinein beobachten, dass sie aus mehrfachen, stakkatoartig hintereinander gesetzten Strichen entstanden ist. Doch auch die grösseren Einheiten sind als Folge konzipiert, indem sie einander variieren und wieder zu neuen Gruppen zusammenfinden, locker auf der Fläche verteilt oder bereits in Reihen gegliedert. Für sich genommen scheinen diese Zeichnungen eine Art von reinem Zeichnen zu demonstrieren, indem jede zeichnerische Veränderung der Bildfläche durch den nachfolgenden Strich relativiert wird. So lässt sich scheinbar das Zeichnen als kontinuierlicher Vorgang beobachten – wäre es wirklich ein aus sich heraus erfolgendes Zeichnen und nicht ein Nach- und Weiterzeichnen, das stets auf eine Vorlage bezogen bleibt und diese endlich im Relief rekonstruiert. Die Nähe zur kompositorischen Sprache der École de Paris ist wohl keine zufällige, denn Kemeny wählte für seine Bilder nicht irgendwelche Formen aus, sondern solche, die dem Kunstverständnis der fünfziger Jahre entsprachen, so wie er zehn Jahre zuvor, noch mit geringerem Echo, seine Vorlagen auf die neofigurative Bildsprache der Nachkriegszeit abgestimmt hatte. Modezeichner und Illustrator, der er war, hatte er gelernt, sich in seinem Metier nach den gängigen Erscheinungsformen zu richten, wie man sie in Paris beobachtete, um sie in die Redaktion einer Schweizer Zeitschrift zu importieren. Dabei wäre es kurzsichtig, darin blossen Opportunismus zu sehen, strebte Kemeny doch nicht eine Karriere als virtuoser Illustrator an, sondern als avantgardistischer Künstler, wofür sein Zürcher Umfeld kaum Entfaltungsmöglichkeiten bot. Man könnte sein Vorgehen vielmehr als eine Praxis in Distanz zu den jeweils dominanten Ausdrucksformen beschreiben, die sich nicht der Polemik oder der kritischen Aggression bedient wie beispielsweise die französischen Décollagisten. Kemeny praktiziert dagegen eine Form der bildnerischen Rede, die man als Paraphrase bezeichnen könnte, da sie weniger sichtbar werden lässt oder sogar verhüllt, was ihn von seinen Zeitgenossen trennt.24 In der Argumentation seiner ersten Kritiker wird immer wieder das Bemühen deutlich, Kemenys Arbeit vom Bereich des Dekorativen zu unterscheiden und ihr mittels der Metapher der Bewegung Autonomie zu verleihen. So schreibt etwa Carola Giedion- Welcker in ihrer nach Kemenys Tod erschienenen Monographie:“Denn das Temperament, von dem diese Metallbilder durchsetzt sind, das rhythmische Wogen, das durch sie hindurchzieht, das Fliessende und Züngelnde dichtgeschichteter Partikelgleichheiten heben das Ganze über das distanziert Dekorative und Schmuckhafte hinaus und machen es zu einer poetisch gesteigerten und gestalteten Aussage.”25
Bewegung ja – aber vielleicht nicht eine den Metallelementen inhärente, organische Bewegung, von der hier die Rede ist, sondern Bewegung als Korrespondenz, die Beziehung von einem Element zum anderen, von einem Ort zum anderen. Kemeny hatte sich dazu seine eigenen Gedanken gemacht: bereits 1955 schrieb er im Vorwort zu seiner Ausstellung in der Zürcher Galerie 16, dass er beim Lesen von Paul Valérys Schriften über die Kunst an die Bewegung, “le mouvement réel”, gedacht habe. Valéry habe das Festhalten eines Handlungsablaufs auf den Bildern “im eisigen Schweigen der Museen” nicht ertragen. “Ich habe bemerkt, dass manche mikrobiologische Photographien von Zellen einander im Zustand des Stillstands sehr ähneln. Dieselben Elemente unterscheiden sich voneinander, sobald sie in Bewegung sind. Es ist also nur die Geschwindigkeit, die die Unterschiedlichkeit ihrer Formen erscheinen lässt. Man dürfte nicht, wie manche es getan haben, nur die wichtigste Bewegung auswählen und sie festhalten. Es ist die Bewegung selber mit ihrer Geschwindigkeit, die das Denken des Menschen ausdrückt.”26 Man könnte diese Konzeption der Bewegung nicht isoliert in den Bildern und Reliefs dargestellt finden, sondern eher im Übergang vom einen Bild zum nächsten, von der Malerei zu den Reliefs, und damit würde man Kemenys Furcht vor dem Stillstand als dem Moment der Indifferenz, in der die einzelnen Elemente in der Unkenntlichkeit verschwinden, ernst nehmen. Sein beinahe zwanghaftes Notieren von potentiellen Bildvorlagen und deren Umsetzung in dem von ihm erdachten Transformationsprozess dienen dazu, Differenzen herzustellen. Kemeny klammert sich dabei nicht an eine endgültige Darstellung, an eine Lösung, sondern beharrt darauf, dass nur die Abfolge – diejenige der Moden in seiner beruflichen Arbeit, der Bildvorlagen in seiner Kunst – von Belang sei: dass alles Malerei, Bild werde, in Bewegung gerate, um sichtbar zu werden. Die Bewegung erhält auf diese Weise nicht den mechanischen und trivialen Sinn wie in der in jenen Jahren propagierten kinetischen Kunst, sondern sie folgt aus der viel tieferen, prozessualen Auffassung der Kunstproduktion heraus, die man nach dem Krieg in Europa wohl am deutlichsten bei Lucio Fontana ausgebildet findet und die sich ihrer Artifizialität stets in hohem Grade bewusst bleibt. So lässt sich auch Kemenys Begriff des Zeichnens und des Rückgriffs auf Natur als eine Tätigkeit lesen, die keineswegs einer organischen Vorstellung folgt, sondern die erneut auf den Übergang, die Transformation zielt, ohne dass damit ein Moment des Anfangs gegeben wäre, das eher Natur ist als ein anderes Moment dieser Folge:“Ich zeichne viel – bis zu dem Augenblick, wo ich nicht mehr weiss, ob ich es bin, der eine Form in der Natur festhält oder ob ich selber Teil der Naturformen bin.”27
In den frühen Zürcher Malereien und später auch in den Reliefs erscheint Kemeny als einer der ersten und originären Vertreter der Neoavantgarden, die sich nach dem Krieg in den verschiedenen Ländern Westeuropas und Nordamerikas zu formieren begannen. Es tritt bei ihm bereits zu diesem Zeitpunkt deutlich die Trennung zwischen Erfindung und produktiver Verwertung, zwischen Methode und daraus abgeleitetem Kunstwerk hervor, die den Unterschied zu den Vorstellungen der ersten Avantgarden der zehner und zwanziger Jahre markiert. Der Arbeitsvorgang, einerseits definiert als Reihe von rekonstruierbaren Entscheidungen, andererseits versehen mit einem utopistischen, oft sozial vermittelten Anspruch, geht über in den Prozess, der sich am Material, am Subjekt oder an dessen Verhältnis zum kulturellen Bildervorrat konstituiert – ein Begriff, der seinerseits bis in die sechziger Jahre hinein in verschiedenen Ausprägungen wirksam werden sollte. Der Maler Kemeny, der sich in der Bibliothek dokumentierte, konnte auf einen Fundus anonymer Volkskunst und auf kunstgewerbliche Leistungen verschiedenster Epochen und Kulturen ebenso zurückgreifen wie auf Klee oder Matisse, deren Vorkriegswerk inzwischen in monographischen Übersichten vorlag. Vergleichbar sind diesem Vorgehen zahlreiche andere Formen von Übertragungen, die gleichzeitig auftreten und die bestimmte vorgegebene kulturelle, soziologische oder wissenschaftliche Elemente als Ausgangsmaterial für eine Kunstproduktion nehmen, in der diese Vorlagen bewusst unkenntlich gemacht oder mindestens einem Entstellungsprozess unterworfen werden. Zu nennen in dieser Reihe von Transformationen vorgegebenen Materials wären der Primitivismus der Gruppe Cobra und Dubuffets art brut ebenso wie die Verwertung geometrischer oder arithmetischer Gesetze bei den Zürcher Konkreten oder bei François Morellet, die Verwendung beliebiger wahrgenommener Formen bei Ellsworth Kelly oder die Décollagen von Hains und Villeglé, wo schon das blosse Vorzeigen des Fundstücks als dessen Entstellung eingesetzt wird. Diese Formen der Nachkriegskunst basieren auf dem Gedanken einer Demonstration von Methoden der Kunstproduktion, die zwar als rekonstruierbar vorausgesetzt werden, aber gleichzeitig dem Werk entzogen sind.
Damit soll nicht Kritik an Kemeny geübt werden; vielmehr erfüllt er geradezu paradigmatisch das Schicksal des Nachkriegskünstlers, der den Einschnitt, den der Zweite Weltkrieg in in die europäischen Kulturen gelegt hatte, als Lücke in sein eigenes Werk einschreibt. Dies geschieht nicht, indem sein Werk diesen Einschnitt als Schweigen oder als Verletzung formulieren würde – es ist gerade umgekehrt: nach einer Karenz von zehn Jahren, während welcher Kemeny sich nicht mit der Malerei beschäftigt hatte, kehrte er 1943 in Zürich zu einer Tätigkeit als Künstler zurück und führte im Exil anhand seiner unerhörten Produktivität und anhand der dokumentarischen Quellen, die ihm zur Verfügung standen, die freie Verfügbarkeit kultureller Fakten vor, die erst recht ein Gefühl von Insuffizienz, die Realität der historischen Zerstörung bezeugt. Es ist wohl ein Gefühl, dem nur mit dem Gedanken der fortwährenden Bewegung beizukommen war. Anmerkungen:
1 Vgl. dafür Hans-Jörg Heusser, Zoltan Kemeny: Das Frühwerk 1943–1953. Katalog der Peintures, Sculptures und Relief-Collages. Basel: Wiese Verlag, 1993. 9
2 Zur Geschichte der Rezeption siehe die ausführliche Darstellung in: Hans-Jörg Heusser, Zoltan Kemeny, a.a.O., S. 12–34.
3 Im posthumen Werkverzeichnis (Gaëtan Picon/Ewald Rathke, Kemeny: Reliefs en métal. Paris: Maeght éditeur, 1973) erscheinen Zeichnungen erstmals als ornamentale Vignetten, eine Verwendung, die sie wieder an den Ort zurückführt, woher Kemeny manche Motive entlehnt hatte. In einigen wenigen Fällen bilden die Autoren Studien zu Reliefs ab (S. 30, 137, 172–173, 176).
4 Galerie Maeght, Zürich, 1980; Galerie Peccolo, Livorno, 1986 (mit Katalog); Galerie Lelong, Zürich, 1993.
5 Zoltan Kemeny, “Lettre à Csaba Sik”, in: Gaëtan Picon/Ewald Rathke, Kemeny: Reliefs en métal, a.a.O., S. 189. Dies hebt auch Ewald Rathke in seinem Aufsatz hervor (ebenda, S. 33).
6 Gaëtan Picon/Ewald Rathke, Kemeny: Reliefs en métal, a.a.O., Nr. 158. 7 Eine erste Erwähnung der vier damals vorliegenden Skizzenbücher findet sich in: Hans-Jörg Heusser, Zoltan Kemeny, a.a.O., S. 64–69. Wie sich im folgenden erweisen wird, können wir seinen Folgerungen allerdings nicht in allen Punkten zustimmen. Seit dem Erscheinen dieser Monographie kamen bei der Räumung der ehemaligen Wohnung der Kemenys 27 Skizzenbücher aus den Jahren 1943 bis 1953 zum Vorschein; es sind nun also insgesamt 31 Skizzenbücher (Schulhefte und Notizblöcke) überliefert.
8 Für Kemenys Modetätigkeit siehe: Mariana Christen und Johanna Gisler, “‘Es sollte tragbar sein und doch chic. Eben schweizerisch.’ Ein Gespräch mit Madeleine Szemere Kemeny”, in: Ganz Annabelle: Eine Zeitschrift als Freundin. Herausgegeben von Mariana Christen, Johanna Gisler, Martin Heller. Zürich: Museum für Gestaltung/Chronos Verlag, 1992, S. 86–95.
9 Gespräche mit Madeleine Kemeny, Zürich, Oktober 1992 und Januar 1993.
10 Henri Matisse: Seize peintures 1939–43. Introduction de André Lejard. Paris: Editions du Chêne, 1943; Paul Klee: Zehn Farbenlichtdrucke nach Gemälden. Ausgewählt und eingeleitet von Georg Schmidt. Basel: Holbein-Verlag, 1945; Roger Lesbats, Cinq peintres d’aujourd’hui: OEuvres de Beaudin, Borès, Estève, Gischia, Pignon. Paris: Éditions du Chêne, 1943.
11 Mit den Skizzenbüchern wurden im Nachlass auch siebzehn Bestellzettel der Bibliothek der Kunstgewerbeschule der Stadt Zürich (heute: Schule für Gestaltung) gefunden, die präzise Auskunft über die von Kemeny bevorzugte Literatur geben.
12 Das Skizzenheft mit der Bezeichnung Bibliothèque I enthält ausführliche Literaturlisten mit den Signaturen der benützten Bücher.
13 Hans-Jörg Heusser, Zoltan Kemeny, a.a.O., Nr. 175.
14 Vgl. dazu den Katalog in: Dieter Schwarz, Zoltan Kemeny: Die Werke im Kunstmuseum Winterthur. Winterthur: Kunstmuseum Winterthur, 1993 (=Schriften zur Sammlung 1).
15 “Pourquoi panger pas la nature? Mais si, je pende ma nature. / Tous les pentres penger pour le montrez comment ils faut pas pendre.” [sic!] – Unbetiteltes Skizzenheft, um 1943, o.S. (Nachlass Kemeny, Zürich).
16 Hans-Jörg Heusser, Zoltan Kemeny, a.a.O., passim.
17 “L’art d’Europe deviendra comme l’art negre, chine, Hindu etc.” [sic!]” – Skizzenheft E, um 1946– 1947, o.S. (Nachlass Kemeny, Zürich).
18 Vgl. die Nr. 4 der Zeitschrift Cobra von 1949, die als Katalog der Amsterdamer Ausstellung diente; sie enthält Abbildungen des Reliefs Festonie von Zoltan Kemeny (S. 16) und einer Zeichnung von Madeleine Kemeny (S. 24) nebst der Liste der ausgestellten Werke.
19 “Je montre comment tous les mondes pouvez faire la peinture.” [sic!] – Skizzenheft D, um 1947–1949, o.S. (Nachlass Kemeny, Zürich).
20 Siehe beispielsweise Constants programmatischen Aufsatz “C’est notre désir qui fait la révolution”, erschienen zur Amsterdamer Ausstellung in: Cobra, Nr. 4 (1949), S. 3–4.
21 “Je reste éternellement sous l’influence de l’art populaire hongrois. Jadis, j’avais la même ambition dans l’écriture du tableau que Béla Bartók dans l’écriture de la musique.” (Zoltan Kemeny, “Lettre à Csaba Sik”, in: Gaëtan Picon/Ewald Rathke, Kemeny: Reliefs en métal, a.a.O., S. 189.)
22 “Ni le passé, ni le futur ne m’intéressent. Seul, le présent. Aujourd’hui, j’aimerais réaliser quelque chose qui exprime ‘l’aujourd’hui’.” (Ebenda.)
23 Vgl. das Gespräch mit Madeleine Kemeny, ebenda, S. 86. 10
24 Paraphrase und nicht Parodie, wie Heusser vorschlägt (Hans-Jörg Heusser, Zoltan Kemeny, a.a.O., S. 37–40), da sich Kemeny jeder Kritik an den Vorlagen enthält und auf deren Inhalt nicht wertend eingeht.
25 Carola Giedion-Welcker, Zoltan Kemeny. St. Gallen: Erker-Verlag, 1968 (=Künstler unserer Zeit, Bd. XV), S. 10.
26 “J’ai remarqué que diverses photographies de cellules microbiologiques ont beaucoup de ressemblance entre elles à l’état d’immobilité. Les mêmes éléments deviennent tout différents lorsqu’ils sont en mouvement. C’est donc seulement la vitesse qui fait apparaître leur différence de formes. Il ne faudrait pas, comme certains l’ont fait, choisir seulement le mouvement le plus important et le fixer. C’est le mouvement lui-même avec sa vitesse qui donnerait corps à la pensée de l’homme.” (Zoltan Kemeny, “Préface de Kemeny pour son exposition, Galerie 16, Zürich 1955”, in: Gaëtan Picon/Ewald Rathke, Kemeny: Reliefs en métal, a.a.O., S. 185.)
27 “Je dessine beaucoup – jusqu’au moment, où je ne sais plus, si c’est moi qui saisis une forme dans la nature, ou si c’est moi-même qui fait partie des formes de la nature.” (Zoltan Kemeny, “Quelques notes”, in: Zoltan Kemeny. Paris: Editions des Musées nationaux, 1966, S. 17.)
Veröffentlich in französisch und englisch in: Zoltan Kemeny. Les donations de Madeleine Kemeny dans les collection du Centre Pompidou. Didier Schulman [Redaktion]
Paris: Musée national d’art moderne, 2004.
Download: Pressedossier des Centre Pompidou zur Ausstellung mit Informationen zu Kemenys Person und Werk (in englischer Sprache)