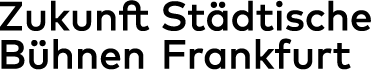Studienarbeit „Theater Provisorium Frankfurt“ von Negin Noury, Universität Kassel Bild: Negin Noury
Erschienen am 4. Oktober 2017 auf nachtkritik.de
Im Interim – Zur Ästhetik und Politik von Ausweichspielstätten
Von Gerhard Preußer
Das Theater muss weichen. Oder zumindest vorläufig ausweichen. Drei große Schauspieltheater in Nordrhein-Westfalen hausen jahrelang in Ausweichspielstätten: Köln, Düsseldorf, Dortmund. Und auch diese drei sind im deutschsprachigen Theater keine Ausnahme: den Theatern in Frankfurt, Oldenburg, der Stuttgarter Oper steht die Ausweichexistenz noch bevor.
Was macht diese Vertreibung aus dem Paradies der großen alten Häuser mit dem Theater? Was, außer dem Organisationsstress hinter den Kulissen, bewirkt dieser weit verbreitete Ausnahmezustand auf der Bühne? Wie verändert er die ästhetischen Konzepte?
Es gibt vier Modelle:
1. Köln Depot 1: Rückentwicklung vom raumspezifischen zum raumneutralen Konzept mit Zuschauertribüne und Vorhang. Die konservativste Lösung.
2. Köln Depot 2 und Düsseldorf Central: Das, was man „Ausweichästhetik“ nennen könnte. Die häufigste und kostengünstigste Lösung für Interimsspielstätten.
3. Dortmund: völlige Flexibilität. Jede Inszenierung erhält ihre eigene Raumstruktur, das räumliche Verhältnis von Zuschauern und Schauspielern ergibt sich aus dem von der Inszenierung gewählten Format. Die riskanteste und für den Theaterapparat strapaziöseste Lösung.
4. Bonn: Abschaffung der Spielstätte mit variabler Raumgestaltung. Die schlechteste Lösung.
Härtefall Köln
Köln Depot 1: Der härteste Fall. Seit fünf Jahren muss das Schauspiel in einer Interimsspielstätte spielen. Mindestens fünf weitere Jahre werden dazukommen. Intendant Stefan Bachmann entschied sich 2013 für eine Fabrikhalle im Stadtteil Mülheim, nachdem seine Vorgängerin Karin Beier schon ein Jahr in der innenstadtnahen Ausstellungshalle „Expo“ untergekommen war. Zentrum oder Peripherie? – das war schon damals die Frage.

Mittlerweile ist das Schauspiel in diesem Randbereich der Stadt fest verankert. Auf dem Gelände der ehemaligen Kabelfabrik Felten und Guillaume gibt es weitere Veranstaltungssäle und Medienunternehmen. Nebenan sind die Restaurants der Keupstraße. Mit auf die Lokalität bezogenen Projekten (u.a „Die Lücke“, „Carlswerk I“, „Die Abschaffung der Nacht“, „Glaubenskämpfer“) und einem trotzig auf den Beton gesetzten Garten hat das Theater dort so tiefe Wurzeln geschlagen, dass Stefan Bachmann dafür sorgen konnte, dass die Spielstätte auch nach dem für 2022 geplanten Rückzug ins renovierte Schauspielhausparadies erhalten bleibt.
Schwierige Akustik
An den Inszenierungen in der großen Halle des Depot 1 lässt sich eine Entwicklung von „theatre on location“ zum Breitwandguckkasten erkennen. Nachdem Raphael Sanchez’ Eröffnungsinszenierung von Michael Frayns „Der nackte Wahnsinn“ im Depot 1 grandios mit dem Versuch gescheitert war, eine Kammerspielkomödie auf Superbreitwandformat umzukopieren, nutzte Stefan Bachmanns Inszenierung von Ayn Rands Der Streik die Weite und Leere des Fabriklagers: echte, mit einer Draisine befahrbare Eisenbahnschienen wurden während der Vorstellung verlegt, ein veritabler DDR-LKW knatterte stinkend durch den Raum. Aber auch die Probleme wurden deutlich: schwierige Akustik, zu große Entfernung für differenziertes Spiel.
Zunächst versuchte man Akustik und Sichtbarkeit zu verbessern, indem man alle Inszenierungen in die Höhe hob: alles fand auf mittlerer Raumhöhe statt. Zur Spielzeit 2016/17 wurde dann die Bühnenbreite verringert, ein Portal eingebaut: nun sieht fast alles wieder so aus wie in einem ordentlichen Schauspielhaus. Die Bühne ist nun wieder ein metaphorischer Raum, der einen anderen, fiktiven Raum bedeutet und als realer im Bewusstsein der Zuschauer verschwindet. Was ein selbstironisches Verhältnis zu dieser Raumkonzeption nicht ausschließt. In Stefan Bachmanns Hamlet-Inszenierung gab es gleich zwei rote Samtvorhänge: einer vor und einer hinter der Bühne.
Köln Depot 2: Die Ausweichästhetik ist ein Mittleres. Es gibt noch die Trennung von Zuschauerraum und Bühne, es gibt noch die kollektive Konzentration auf das fiktive Spiel, aber der Raum ist offen, ohne Portal. Die Grenze wird verwischt. Der Schauspieler geht sichtbar seinen Gang als Schauspieler auf die Bühne, auf der er sich verwandelt. Die Bühne ist ein metonymischer Raum (in Hans-Thies Lehmanns Terminologie), der ein Teil des realen Raums bleibt (der Halle), immer als solcher wahrgenommen wird und dennoch für einen anderen Raum steht. Die Fabrikhalle mit ihrer Atmosphäre der Produktion, der Arbeit, der ungemütlichen Effizienz temperiert untergründig die Wahrnehmung des Publikums. So ist die Mehrheit der Inszenierungen im Kölner Depot 2 angelegt.
Auch in der „Außenspielstätte am Offenbachplatz“ dominiert diese Raumkonzeption. Es war wieder eine strategische Entscheidung Bachmanns, sich diese Spielstätte zu erobern: das halbfertige neue „Kleine Haus“ auf der ewigen Baustelle des Opernquartiers. So ist das Theater wieder mit einem Fuß, oder zumindest einem kleinen Zeh, in der Mitte der Stadt, wo es nach Bachmanns Meinung hingehört. Von ihm kann man seltsam unzeitgemäße Forderung hören, Rathaus, Kirche und Theater gehörten ins Zentrum der Stadt.
Vertriebene in Düsseldorf
Das vielseitigste Konzept für delokalisiertes Theater hat das Düsseldorfer Schauspielhaus. Intendant Wilfried Schulz dachte bei Vertragsunterzeichnung, er käme in ein renoviertes Haus, nun zeigt sich, er bleibt bis Herbst 2019 Vertriebener. Seine Antwort ist offensiv: die Zerstreuung nutzen. Im kleinen Raum des Central, einer früheren Lagerhalle der Post neben dem Hauptbahnhof, gibt es Ausweichästhetik, man schaut von der Tribüne herab in die Ebene der Spielfläche. Im großen Raum ist kaum mehr möglich: Daniela Löffner lässt in ihrer Version der „Farm der Tiere“ in der Raummitte in einem Karree von Zuschauertribünen spielen.
Selbst Rimini Protokoll musste ihr Stationenlernen zum Thema Gesellschaftsmodell Großbaustelle im unveränderten Raum mit Zuschauertribüne platzieren, obwohl diese interaktive Installation mit kunstvoll umeinander geführten Zuschauergruppen einen ganz anderen Raum benötigt hätte. Daneben versucht Schulz mit einem Zirkuszelt neue Plätze für das Theater zu erschließen. Bei der Eröffnungsinszenierung Gilgamesh erinnerten aber nur die ihre Körper durch die Luft schleudernden Akrobaten in Nebenrollen daran, dass man im Zirkus war. Keine Arena, sondern das altbekannte Verhältnis von Zuschauertribüne und Bühne.
Mit Faust to go, einer schülergerechten Klassikerinszenierung, wird das Theater noch mobiler und tourt durch die Schulen und Bürgerhäuser. Anderseits hat Schulz wie Bachmann in Köln auch eine Offensive zur Rückkehr gestartet: Robert Wilsons Sandmann-Muscial wurde im nur durch den Hintereingang zugänglichen, eigentlich geschlossenen, der Renovierung harrenden Schauspielhaus gezeigt und alle Freunde des Schauspielhauses waren überglücklich, wenigstens vorübergehend in ihren repräsentativen Raum zurückzukehren.
Dortmund: So widersprüchlich erfolgreich die Situation in Köln und Düsseldorf ist, so eindeutig erfolgreich ist sie in Dortmund. Die Vertreibung aus dem kleinen Paradies des Schauspielhauses in die Lagerhalle des Megastores im Stadtteil Hörde war für das Team um Intendant Kay Voges eine Befreiung. Nun konnte man endlich genüsslich vom Baum der Erkenntnis naschen. Die erste Inszenierung, Jelineks Das schweigende Mädchen, inszeniert von Michel Simon, führte das Publikum zunächst in einen Raum, in dem an verschiedenen Orten Schauspieler in unterschiedlichen Bühnenbildfragmenten sprachen: freie Aufmerksamkeitslenkung bei allgemeiner Dekonzentration, ein Massenpublikum als Individuen behandelt.
Dortmunds Theater in einer alten Fanartikel-Halle des BVB
Erst danach kam man auf eine Zuschauertribüne, aber auch im zweiten Teil wurde die Weite des Raumes durch einen Bürgerchor genutzt. Marcus Lobbes nutzte Mike Daiseys Trump-Monolog für ein eigenes Raumformat: Wahlparty mit Stehtischen. Auch Kay Voges’ vielgepriesene Borderline-Inszenierung mit ihrem riesigen Filmset zwischen zwei Zuschauertribünen wäre im Schauspielhaus völlig unmöglich gewesen. Weil sich in der Halle des „Megastore“ neben der Ruine des Hoesch-Stahlwerks „Phoenix“ im Stadtteil Hörde drei Räume herstellen ließen, war weiterhin bei verringerter Zuschauerzahl ein reduzierter Repertoirespielplan möglich.
Lokale Verankerung war nicht Voges’ Ziel, angesichts der kürzeren Umbauphase (Februar 2016 bis Dezember 2017) verständlich. So grüßen die rostigen Hochofentürme nur als bezugslose Reminiszenzen herüber zur ehemaligen BVB-Fan-Artikel-Halle. Ab Dezember kehrt man zurück ins Paradies. In die Erleichterung über das Ende der miserablen Arbeitsbedingungen für die Theatermacher mischt sich das Bedauern über den Verlust der Variabilität des Raumes.
Bonn: Die fragwürdigste Lösung hat man in Bonn gefunden. Um der Reduzierung des Theateretats zu entsprechen, wurde die alternative Spielstätte, die Halle Beuel, der Ort, an dem so viele bahnbrechende Raumkonzepte ausprobiert worden waren (z.B. bei der Uraufführung von Jelineks „Wolken.Heim“ oder Peter Palitzschs „Antigone“), aufgegeben und das Schauspiel auf die Kammerspiele in Bad Godesberg, ein ehemaliges Kino, und das kleine Nudelbrett der Werkstattbühne im Untergeschoss der Oper reduziert. Die für ein jüngeres Publikum attraktive Halle einer alten Jutespinnerei im rechtsrheinischen, universitätsnahen Vorort Beuel wurde an ein privates Kleinkunsttheater vermietet. Das ist die am wenigsten zukunftsorientierte Lösung für das Schauspiel.
Erhaltung und Bewahrung
Die Notwenigkeit der Renovierung dieser großen Häuser ist durch die Verschleppung von Instandhaltung und Instandsetzungsmaßnahmen entstanden. Sowohl in Düsseldorf als auch in Köln wurden dadurch große öffentliche Debatten ausgelöst, die mit dazu geführt haben, dass diese Projekte – wie langsam auch immer – angegangen werden. Zeitweise stand das Theater in Köln und Düsseldorf im Zentrum der lokalpolitischen Debatte.
Diese Debatten waren aber zweischneidig. Ihr Impuls war immer Erhaltung und Bewahrung. Nur so, scheint es, kann man in der deutschen Abstiegsgesellschaft politische Partizipation mobilisieren. Den Theatermachern gelang es nur geringfügige Zugeständnisse für die Umgestaltung der Bühnen und Zuschauerräume zu erreichen. Wie bei fast allen Renovierungen wird entsprechend der gesunkenen gesellschaftlichen Bedeutung der Theater der Zuschauerraum verkleinert (was die Auslastungsstatistik verbessert). In Köln soll es eine bewegliche Vorbühne geben, in Düsseldorf soll der Eingangsbereich zur Stadt hin geöffnet werden.
Ähnlich hat in Bochum der künftige Schauspiel-Intendant Johan Simons durchgesetzt, dass im Bochumer Großen Haus die Grenze zwischen Zuschauerraum und Bühne entschärft werden kann, indem Zuschauer auf der Bühne platziert werden können. Das sind nur marginale Änderungen an dem durch die Bauten der 50er oder 60er-Jahre vorgegebenen Raumkonzept.
Dabei gab es schon einmal auch für solche Bauten ganz andere Konzepte. Das Kleine Haus in Düsseldorf wurde 1970 gebaut als „Raumbühne“, die ohne feste Zuschauertribüne mit vertikal beweglichen Zuschauer- und Bühnenflächen bespielt werden konnte. Ebenso wurde das Essener Grillo-Theater 1990 zum „variablen Raumtheater“ umgebaut. In beiden Fällen gingen die Architekten auf die Ideen von Piscator, Gropius u.a. aus den 20er Jahren zurück. Doch diese innovativen Raumstrukturen wurden nur kurze Zeit genutzt. Zu teuer, zu kompliziert waren die Umbauarbeiten für einen Repertoirespielplan.
Vergessene Zukunft
Im Laufe der Jahre wurde das technische Personal weiter reduziert. Für Variabilität war weder Zeit noch Geld da. Die Raumästhetik des deutschen Stadttheaters ist auch eine Finanzfrage. Wenn also z.B. Milo Rau, designierter Intendant des Nationaltheaters Gent, klagt über „Stadttheateräume, die zwar über die ganze Infrastruktur verfügen, aber überhaupt nicht adaptabel sind für die Realität des Theaters“, so trifft das nicht die Interimsspielstätten, wohl aber die alten Prachtbauten.
Aber die Klage ist auch alt und die Konzentration der öffentlichen Debatte auf die Substanzerhaltung hat die Wiederbelebung der alten Pläne für eine neue Zukunft des Stadttheaters vergessen lassen. Eine Bürgerinitiative für den Umbau des Kölner Schauspielhauses zur variablen Raumbühne bleibt undenkbar. Denn, wie Dirk Baecker so schön formulierte, eine Ungleichzeitigkeit hat sich der Menschen bemächtigt, „demgemäß ihre Praxis […] in der jeweils gegenwärtigen Medienepoche stattfindet, ihr Verstand sich auf dem Niveau der vorherigen bewegt und ihr Gemüt noch in der vorletzten steckt“.
Theater in der Mitte UND an den Rändern!
Die Schauburgen in den Stadtzentren aufzugeben, abzureißen (worüber der Düsseldorfer Oberbürgermeister laut nachdachte), am Stadtrand neu zu bauen (wie man in Köln überlegte und wie es jetzt in Frankfurt in der Diskussion ist) würde der Tendenz zur Dezentralisierung und Enthierarchisierung aller gesellschaftlichen Bereiche entgegenkommen. Aber auch eine Gesellschaft aus sich selbstregulierenden, autopoetischen Subsystemen braucht ein zentralisiertes, hierarchiebildendes, politisches System (Niklas Luhmann). Das Theater als per Struktur politisches Medium kann in einer Stadt eine solche zentralisierende Funktion übernehmen. Deshalb gehört es in ihre Mitte.
Andererseits ändern sich unter dem Einfluss des Internets und der sozialen Netzwerke die Strukturen von Kommunikation und Sozialität. Darauf reagiert das Theater. Dazu bedarf es anderer Raumstrukturen. Diese kann es in den Hallen der Interimsspielstätten am Rand finden. Was brauchen wir also? Eine pluralistische Lösung: Umwidmung der provisorischen Spielstätten zu dauerhaften, dezentralen Außenspielstätten und Flexibilisierung der Raumstruktur bei der Renovierung der zentralen Häuser: Interim zu Evergreen, Guckkasten zu bunter Box und Geld für variable Stadttheater.
Gerhard Preußer, geboren 1950. Studium Philosophie, Anglistik und Germanistik. 1980-2015 Gymnasiallehrer. Seit 1987 freier Mitarbeiter für Theaterkritik in Nordrhein-Westfalen bei verschiedenen Medien (taz, WDR etc.). Schreibt seit 1990 für Theater heute, seit 2015 für nachtkritik.de. 2001-2004 Mitglied der Jury des Berliner Theatertreffens.