Bild: Uwe Dettmar
Erschienen auf Marlowes, 17. März 2020
Noch hat Frankfurt das Image einer weltoffenen Stadt mit vielfältiger Kultur. Nicht nur die Paulskirche, auch die Rolle als Vorzeigestadt der Moderne ist Teil dieser Identität: In den 1920er Jahren das Neue Frankfurt, eine international gefeierte Modellstadt der sozialen Stadtplanung, nach dem Zweiten Weltkrieg das in der Architektur des Wiederaufbaus manifestierte Bekenntnis zum demokratischen Neuanfang in der Metropole des Wirtschaftswunders. Doch dieses Image ist bereits ausgehöhlt.
Von Sandra Pappe
Immer eiliger werden die Symbolbauten der Moderne aus dem Stadtbild getilgt, vorzugsweise ersetzt durch Imitate einer vormodernen Bebauung. Eine Geschichtsverfälschung, der nach einem überraschenden Beschluss Ende Januar jetzt ein weiteres Wahrzeichen demokratischen Kulturverständnisses zum Opfer fallen soll: die Doppelanlage für Schauspiel und Oper der Städtischen Bühnen. Und kaum hatte die Stadtverordnetenversammlung deren Abriss beschlossen, schon standen Investoren und Privatinitiativen mit Visualisierungen und PR-Broschüren für ihre Vorstellungen eines Theater-Neubaus parat. Der Projektentwickler Groß & Partner zeichnete das Bild eines spektakulären Eventpalastes inklusive Aussichtsplattform und Flaniermeile direkt am Mainufer, der „unserem“ Frankfurt „in der Zukunft hilft, unsere Stellung im Städteranking zu halten und zu steigern“. Die Frankfurter Freunde der Rekonstruktion waren mit einer neuen Initiative dabei: Dieses Mal soll das historistische Schauspielhaus von 1902 wieder aufgebaut werden. Schon vor mehr als einem Jahr hatte eine private Bürgerstiftung angekündigt, großzügig spenden zu wollen – allerdings nur gegen die Bedingung, die Bühnen in Zukunft privat betreiben und damit nicht an die öffentlichen Vergabeverfahren – als auch den Architektenwettbewerb – gebunden zu sein.
Investorenparadies Frankfurt – wem gehört die Stadt?
Das Auftreten der Investoren demonstriert, in welchem Ausmaß sich Privatwirtschaft und Populisten mittlerweile als nicht einmal mehr heimliche Herren Frankfurts wahrnehmen – und das auch nach außen signalisieren. Die Selbstverständlichkeit, mit der Investor Jürgen Groß mal in selbst ernannter Vertretung der Stadt über ein langfristig anderweitig verpachtetes Grundstück für seinen Vorschlag für die Städtischen Bühnen verfügt, mal einen renommierten Stararchitekten ohne dessen Wissen für seine Marketingkampagne missbraucht, steht dem Gehabe eines Feudalfürsten in nichts nach. Mit demselben Zynismus, mit dem sich Groß für seine an der Bürgerschaft vorbei errichteten Projekte als „Weggefährte und Partner der Stadt“ feiert, täuschen die Populisten der Aktionsgemeinschaft Schauspielhaus, bestärkt durch die erfolgreich durchgesetzte „Rekonstruktion“ der Altstadt, eine breite Zustimmung der Bevölkerung für ihren Wunsch nach einem Stadtrückbau vor.
Sie könnten sich das nicht leisten, ließe ihnen die politische Führung der Stadt nicht den Spielraum dazu. Die Art, wie einige der gewählten Repräsentant*innen ihre politischen Verantwortlichkeiten an privatwirtschaftliche Akteure oder einflussreiche Bürger auslagern, hat ebenso wenig mit einer Bürgerbeteiligung zu tun wie eine Diktatur des Massengeschmacks mit Demokratie.
In der architektonischen Umgestaltung des Stadtbilds spiegelt sich das wider. Frankfurt hat sich schon lange einen Ruf als Investorenparadies gemacht, in dem Politiker leicht das Augenmaß verlieren, wenn wirtschaftliche Erfolgsversprechen gemacht werden. Auf dem Altar der Geschäfte städtische Werte und gesunden Menschenverstand gleichermaßen zu opfern, ist in Frankfurt nichts Neues, man denke an den Skandal um den Immobilienunternehmer Jürgen Schneider oder die Affäre um die Diamantenbörse. Welche öffentlichen Werte und Besitztümer die Stadt dieses Mal zu opfern bereit ist, sprengt allerdings den Rahmen des bisher üblichen.
Ein Geschenk an die Frankfurter
Die 1963 eingeweihten und von ABB Architekten errichteten Städtischen Bühnen symbolisieren mit ihrer zum Willy-Brand-Platz verglasten Fassade ein Geschenk der jungen Demokratie an die Frankfurter Stadtbevölkerung: ein Bekenntnis zur offenen Gesellschaft, das Hilmar Hofmanns „Kultur für Alle“ vorwegnahm. Hier sollte kein elitärer Kulturtempel für die Oberschicht entstehen, sondern ein Ort ohne Hemmschwelle, der alle Schichten der Stadt gleichermaßen willkommen heißt. Für die Ausgestaltung des Foyers wurden – ungewöhnlich für diese Zeit – gleich zwei jüdische Künstler von Weltformat engagiert. Chagalls Gemälde „Commedia dell’Arte“ wurde ebenso wie die Deckenskulptur „Goldwolken“ des Künstlers Zoltán Kemény speziell für das Foyer angefertigt. Diese letzte große Arbeit des auf der Biennale von Venedig 1964 mit dem Großen Preis für Plastik ausgezeichneten Künstlers ist mit dem Gebäude untrennbar verbunden. Ein Kunstwerk, um das die Stadt Frankfurt beneidet wird – das die Herren der Stadt aber offenbar nicht zu schätzen wissen. Obwohl die Denkmalschutzwürdigkeit des Wolkenfoyers unbestritten ist, wurde es bislang nicht in die Denkmalliste der Stadt Frankfurt aufgenommen.
Mit dem Totalabriss würde die Stadt ein wertvolles Kunstwerk aus dem Besitz der Frankfurter Bürger gleich mit zerstören. Bei einem solchen Umgang mit öffentlichem Kulturgut, dessen Verlust einzelne Volksvertreter bedauerten, von Kosteneinsparungen zu reden, ist ein Hohn. Unfassbar, dass eine Teilsanierung mit dem Erhalt wenigstens des Kulturerbes Wolkenfoyer nicht einmal in Erwägung gezogen, geschweige denn geprüft wurde. Da eine denkmalpflegerische Dokumentation und Analyse nicht stattfand, ist nicht einmal geklärt, welcher finanzielle Verlust der Stadtgemeinschaft durch die Vernichtung des Gesamtkunstwerks entsteht. Allein diese Unterlassung stellt die Kostenschätzungen, auf denen die politische Entscheidung für den Abriss beruht, in Frage.
Dabei wäre ein Teilerhalt bautechnisch ebenso im Rahmen des Möglichen wie die Sanierung der Glasfassade – der Sanierungsbedarf an Foyer und Saal sei vergleichsweise gering, wie der Architekt Stefan Forster bei einer Pressekonferenz zu einer Petition zur Zukunft der Städtischen Bühnen am 9. März erklärte. In einem offenen Brief an die Stadtfordern die Unterzeichner unter anderem, das Wolkenfoyer und andere schützenswerte Gebäudeteile unter Denkmalschutz zu stellen.
Angriff auf Kultur für alle
Der Totalabriss gefährdet aber nicht nur ein bauliches Kulturerbe. Auch die inhaltliche Ausrichtung der Bühnen steht auf dem Spiel. Im Gegensatz zur Bausubstanz ist die dem Baudenkmal zugrunde liegende Kulturauffassung nicht sanierungsbedürftig, im Gegenteil. Das Konzept der Bühnen ist ein Erfolgsrezept, dass bei Oper- und Theaterbetrieb dauerhaft für eine außergewöhnlich hohe Auslastung sorgt, mehrfach wurden die städtische Institution mit dem Titel „Opernhaus des Jahres“ ausgezeichnet.
Warum also der auch von Intendant Bernd Loebe betonte angebliche „Bedarf“ nach einem Ausbau der Spielstätten? Warum sollte der von ihm anvisierte Neubau größer ausfallen als das derzeitige, warum sollte es „1.500 – 1.800 Zuschauer“ aufnehmen können? Steckt dahinter wirklich eine realistische Einschätzung dessen, welches Kulturangebot dem Bedarf der Einwohnerschaft Frankfurts entspricht oder träumt die Intendanz denselben Traum vom Mithalten mit Opernhäusern in Hamburg, Sidney oder Bilbao wie Projektentwickler Jürgen Groß? Sind solche Fitzcarraldo-Fantasien wirklich zeitgemäß oder wäre für die kommenden 20 bis 30 Jahren ein Gesundschrumpfen nicht eher angesagt als ein Festhalten am Wachstumswahn? Ist es im 21. Jahrhundert nicht sinnvoller, auf den Austausch kultureller Netzwerke zu setzen, statt sich im Wettbewerbsdenken vergangener Tage um jeden Preis gegenseitig zu übertrumpfen? Fragen, die nie gestellt wurden.
In jedem Fall ist schwer vorstellbar, dass das vielfältige Repertoire der städtischen Bühnen, das vom Anstoß kultureller Diskurse lebt, noch Raum in den repräsentativen Neubauten finden wird, von dem Frankfurts Eliten träumen. Das Publikum aus allen Schichten der Gesellschaft, das für diese Inhalte so zahlreich erschienen ist, wäre dort ohnehin nicht mehr willkommen. Die Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung ist nicht nur ein Angriff auf ein Bauwerk – sie ist ein Angriff auf den städtischen Kulturbetrieb an sich.
Verfahrensmängel und ein zweifelhafter Beschluss
Im Ergebnis der Machbarkeitsstudie 2017 lagen die Kostenschätzungen für die Varianten zwischen Sanierung und Abriss noch dicht beieinander im Feld von 800.000 Euro. Die höchsten Kosten wurden damals für Abriss und Neubau geschätzt. Auch im nach wie vor nicht im Original veröffentlichten Gutachten, das die Stabsstelle „Zukunft der städtischen Bühnen“ unter der Leitung von Michael Guntersdorf 2020 vorstellte, sind die Unterschiede der Varianten geringfügig. Dieses Mal steht allerdings die Sanierung plötzlich als teuerste Variante da.
Aus Schätzungen, die gerade einmal um zehn Prozent differieren, die Begründung eines Abrisses aus Kostengründen herzuleiten, ist an sich schon grotesk – selbst wenn das für den Abrissbeschluss Ausschlag gebende Gutachten von 2020 öffentlich zugänglich wäre, selbst wenn die Stadtverordneten für die Prüfung und anschließende politische Willensbildung mehr Zeit gehabt hätten als die wenigen Tage, die zwischen Gutachtenfertigstellung und Beschluss lagen: Die mit Hinblick auf die Sanierung gezogene Schlussfolgerung, die Kosten seien zu hoch, die Vorteile zu gering, könnte man ergo genauso gut auf Totalabriss und Neubau beziehen – je nachdem, ob man das städtische Wahrzeichen aus den 1960er Jahren schätzt oder nicht.
Angesichts des bisherigen Verfahrensverlaufs muss man sich fragen, ob hier wirklich die Durchführbarkeit einer Sanierung geprüft oder eine Rechtfertigung für einen Neubau konstruiert werden sollte. Wurden die Kosten für die Sanierung künstlich in die Höhe getrieben, um die viel kritisierten hohen Kosten für einen Neubau zu relativieren, der im Gutachten von 2017 noch die teuerste Variante war? Schon die Höhe der 2017 geschätzten Sanierungskosten weckte Zweifel. In seiner Stellungnahme zur Machbarkeitsstudie von 2017 mahnte Hans Erhard Haverkampf, ehemaliger Baudezernent der Stadt Frankfurt, Inkorrektheiten bei der Berechnung an. Die von ihm veranschlagte Schätzung lag noch weit unter 200.000 Euro – ein Bruchteil der aktuell veranschlagten Summe.
Den Vorschlägen zur Privatisierung hat der Leiter der Stabsstelle „Zukunft der städtischen Bühnen“, Michael Guntersdorf, eine öffentliche Abfuhr erteilt. Der Geschäftsführer der DomRömer AG, die den Bau der neuen Altstadt zu verantworten hat, weiß wovon er spricht und kennt sich mit den Interessenslagen privater Investoren und rechtspopulistischer Agitatoren gleichermaßen bestens aus.
Seine abfälligen Kommentare zum Bühnengebäude am Willy-Brand-Platz klingen verdächtig nach dem auch bei den Rekonstruktionsliebhabern beliebten Moderne-Bashing, das den Bauten der 1950er und 60er Jahre alle gestalterische und architektonische Qualität abspricht und diese Geschmacksfrage zum „Willen der Bürgerschaft“ zu deklarieren versucht. Den Gegenstand eines Gutachtens, das als politische Entscheidungsgrundlage für dessen Zukunft dient, öffentlich als „Kiste“, die „weg müsse“, „sich überholt habe“ zu titulieren, weckt berechtigte Zweifel an der für eine solche Befugnis zwingend notwendigen Unbefangenheit. Ein Erhalt des Foyers kommt für Guntersdorf auch deshalb nicht in Frage, weil ihm das Baudenkmal, das „wie eine Kneipe nur abends gewinnt“ offensichtlich persönlich nicht gefällt.
Wenn Repräsentanten städtischer Politik sich an Geschmacksfragen abarbeiten, lenken sie nicht nur davon ab, dass die Stadt an den Bedürfnissen der breiten Bevölkerung vorbei regiert – sie arbeiten auch rechtsextremen Populisten in die Hände. Gerade die Überbewertung populistischer Geschmacksfragen legt das größte Manko des gesamten Verfahrens offen: Eine öffentliche Debatte der Mandatsträger mit der Stadtgesellschaft über die Erwartungen, die diese an einen städtischen Theaterbetrieb in der Tradition einer für alle Gesellschaftsschichten offenen Kultur ohne Hemmschwelle stellen, hat nie stattgefunden. Diese muss aber zwingend an erster Stelle der Planung stehen. Die Stadt hat den zehnten Schritt vor dem ersten gemacht.
Die ständige Beschwörung der „Zukunftsfähigkeit“ der Städtischen Bühnen, die Abriss und Neubaupläne rechtfertigen soll, wird ohne diese Grundlage zum Bumerang. Zum Beispiel beim Thema technische Ausstattung: Es ist nicht weiter überraschend, wenn ein Jürgen Groß noch nie etwas von Digitalsparen gehört hat und allen Ernstes behauptet, „wenn die Kultur Bestand haben möchte, gerade mit Blick auf die neuen Medien und technischen Möglichkeiten, muss sie funktionsfähig sein.“ Selbstverständlich interessiert sich ein am Effektegewitter digitaler Firmenevents orientierter Investor, der intellektuell genauso in den 1990er Jahren stecken geblieben ist wie die Frankfurter Rekonstruktivisten im 19. Jahrhundert, nicht für kulturrelevante Fragen. Beispielsweise die, ob die Besucher der Städtischen Bühnen die hinter den Schauspielern eingeblendeten digitalen Bespielungen wirklich als kulturelle Bereicherung wahrnehmen oder auch ohne Bedauern darauf verzichten würden.
Die Mandatsträger einer unter dem Mangel an bezahlbarem Wohnraum, maroden Schulen und kaputt gesparter Infrastruktur leidenden Stadtbevölkerung sollten sich Fragen wie diese allerdings stellen. Lieber sprechen sie aber von den Interessen des jungen Publikums, für das die Bühnen in 20 Jahren noch attraktiv sein sollen. Also der Generation, die zur Zeit weltweit wegen der Klimakatastrophe auf die Straße geht und gegen ein Weiter-So demonstriert. Da wird es sicher gut ankommen, die Vernichtung grauer Energie zugunsten eines auf Wachstums- und Wettbewerbsideologie ausgerichteten Neubaus als „nachhaltig“ zu verkaufen. Frankfurts selbst verliehener Beiname „Green City“ gilt bei Klimaaktivist*innen ohnehin nur als die hohle Marketingphrase einer Stadt, die unter Nachhaltigkeit weniger den Schutz des Klimas als den Schutz der Wirtschaft vor den Forderungen der Klimaschützer versteht.
Gegenwärtig stellt das Coronavirus die Zukunft von Veranstaltungsstätten generell in Frage, die Prognosen der Wissenschaft zur Klimakatastrophe werden von den Meldungen aus aller Welt noch übertroffen, immer breitere Teile der Bevölkerung sorgen sich um die Sicherheit ihrer existentiellen Grundversorgung. Die Chancen stehen schon schlecht genug, den Kulturbetrieb in den nächsten Jahren ohne große Abstriche so zu erhalten, wie er jetzt ist. Die Vorstellung, in dreißig Jahren gäbe es in Frankfurt noch die Infrastruktur, die finanziellen Ressourcen und vor allem den Bedarf für darüber hinausgehende Prestigeprojekte ist mehr als realitätsfern – das entspricht dem geistigen Niveau der Klimawandelleugner.
Für die Zukunft der Bühnen suggerieren Politik und Investoren im Schulterschluss, die Würfel seien längst gefallen und jeder Widerstand zwecklos. Eine Haltung, mit der die Stadt auch die Aktivist*innen des Radentscheids abzuspeisen versuchte. Mittlerweile hat sich die Stadt die gegen ihren massiven Widerstand erzwungenen Zugeständnisse an die Radfahrer auf die eigene Fahne geschrieben. Ein Signal, vorgeblich endgültige Beschlüsse nicht einfach hinzunehmen – und die bislang versäumte Debatte nachzuholen. Was passiert, wenn die Zivilgesellschaft nicht aktiv wird, zeichnet sich bereits ab: Luxusappartements am Willy-Brand-Platz statt „Kultur für Alle“ – es wäre nicht das erste Mal, dass die Stadtpolitik ihre Bürger mit Zugeständnissen an die Privatwirtschaft überrascht, denen sie eben noch eine markige Abfuhr erteilt hat.
Publikation mit freundlicher Genehmigung von Sandra Pappe
Sandra Pappe ist Fachautorin und Illustratorin. Sie machte ihren Abschluss im Fachbereich Architektur an der FH Darmstadt und verlegte sich nach Aufbaustudiengängen für Onlineredaktion und Buch- und Medienpraxis auf das Publizieren. Sie betreibt den Blog architektur-ist-politik.de und hat unter anderem einen Architekturführer für die Stadt Frankfurt veröffentlicht.
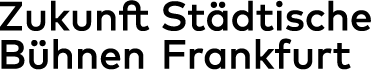

…ein Bericht des WDR, sollten alle lesen, die sich mit den Städtischen Bühnen Frankfurt beschäftigen:
Vor zehn Jahren: Kölner Rat kippt Beschluss zum Neubau von Schauspielhaus
Von Jochen Hilgers
Neubau wird zugunsten Sanierung gestoppt
Kosten außer Kontrolle
Kultur-Initiative schaffte Stimmungswechsel
Es scheint ein Fass ohne Boden: Die Sanierung der Kölner Bühnen soll weitere 15 Millionen Euro kosten. Im schlimmsten Fall könnten die Gesamtkosten auf rund 900 Millionen Euro steigen. Und dabei war alles ganz anders gedacht. Für rund 280 Millionen Euro sollte die Oper saniert, das Schauspielhaus neu gebaut werden. Alle Pläne waren fertig. Die Architekten wollten beginnen. Bis sich plötzlich eine Initiative von Kulturschaffenden zusammenfand, die sich „Mut zur Kultur“ nannte.
Innerhalb kürzester Zeit mobilisierten sie Teile der Kölner Öffentlichkeit und die Politik. Sie schafften das scheinbar Unmögliche. Vor genau zehn Jahren im April 2010 kippte der Rat den Neubau-Beschluss und entschied sich später für eine Sanierung. Das Kölner Bühnendesaster nahm seinen Anfang.
Stimmung kippt
Der Opernintendant freute sich damals auf den Neubau. Uwe Eric Laufenberg ist heute Intendant in Wiesbaden und denkt im Skype-Interview mit Schrecken an das Jahr 2010 zurück. „Wenn eine gewisse Stimmung erzeugt wird, dann ist das wie eine Herde, die anfängt zu rennen, dann kommen sie mit keinem Argument mehr durch.“ Laufenberg spielt auf die Bewegung „Mut zur Kultur“ an. Darin hatten sich überwiegend Kulturschaffende gefunden, die plötzlich das Schauspiel- und das Opernhaus in ihren Ur-Zuständen erhalten wollten. Es gab Demonstrationen. Ein Karnevalswagen mit eindeutiger Botschaft zum Erhalt wurde durch die Stadt gezogen.
„Mut zur Kultur“ sieht kaum eigene Fehler
Einer der Initiatoren von „Mut zur Kultur“ ist der Journalist und Kunsthändler Jörg Jung. Er ruht in sich. Gravierende Fehler habe die Bewegung nicht gemacht, findet er. Wenn überhaupt, dann sei es falsch gewesen, zu vieles zu schnell gewollt zu haben. Über die Kostenexplosion reden die Kulturschaffenden generell nicht gerne.
CDU fällt um
Die Politik ließ die Protestbewegung „Mut zur Kultur“ nicht unbeeindruckt. Vor allem in der CDU, die zunächst für den Neubau ist, gärte es. Die Partei fiel schließlich um. Der kulturpolitische Sprecher der Partei, Ralph Elster, sagt heute. Damals sei es wie eine Welle durch die Bevölkerung geschwappt und habe auch die CDU-Fraktion eingenommen. Wenn man zurückschaue, hätte man vieles besser machen können. Der Kölner SPD-Landtagsabgeordnete Jochen Ott wird deutlicher. Es sei eine egoistische Initiative gewesen. Für das Geld hätten wir zwei Schauspielhäuser in perfekter Neuausgestaltung haben können.
Oper und Schauspielhaus in Köln: Sanierung dauert länger | mehr
Stand: 22.04.2020, 18:07
Lieber Herr Guntersdorf, wir in Frankfurt können uns glücklich schätzen, dass das Revisionsamt 2011 ein Gesamtsanierungskonezpt eingefordert hat und damit verhindert hat, dass die Stadt in das gleiche Schlammasel gerät wie in Köln. Es ist unverantworlich, Entscheidungen zu treffen und mit Arbeiten zu beginnen, wenn die Sachlage nicht klar ist. Doch ein Plädoyer für den Komplettabriss folgt daraus nicht. Philipp Oswalt
Meine Frau und ich sind alte Freunde der Oper Frankfurt und des Schauspielhauses.
Sanierung oder Neubau sollte nur am heutigen Standort
stattfinden.